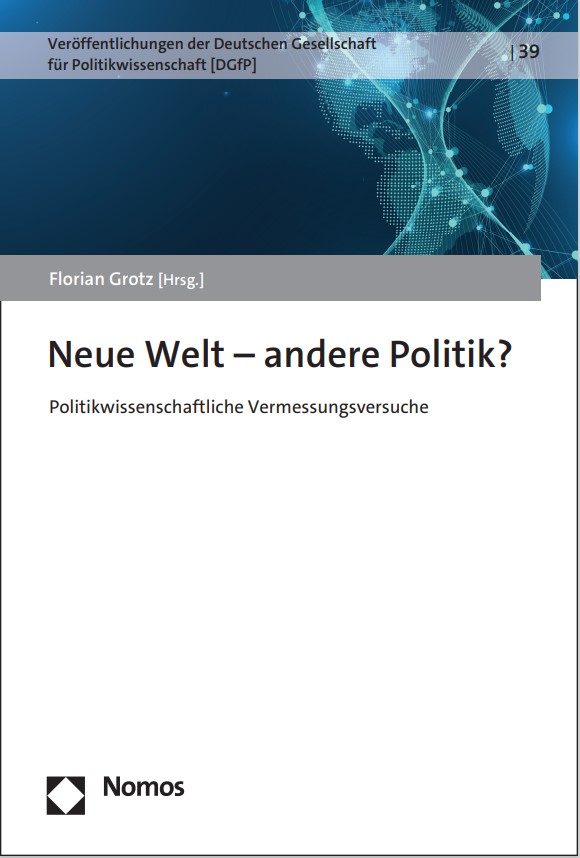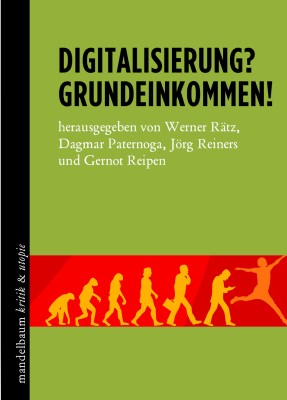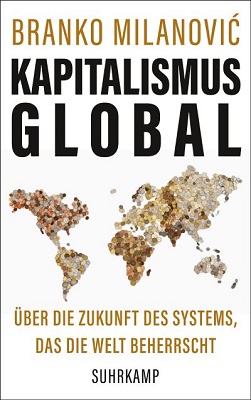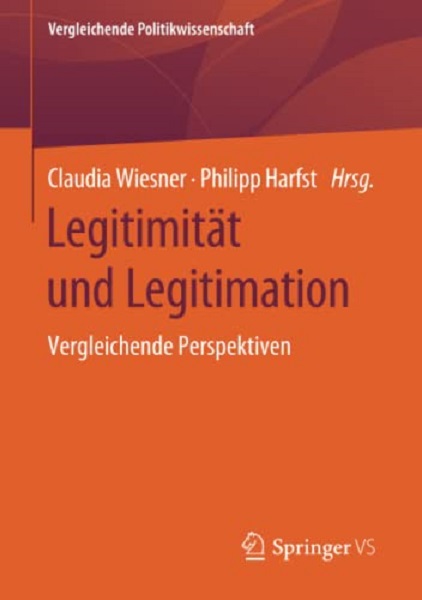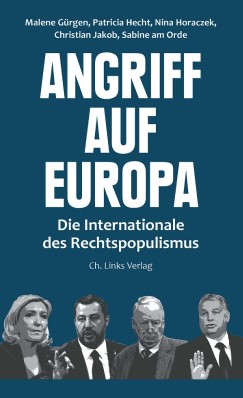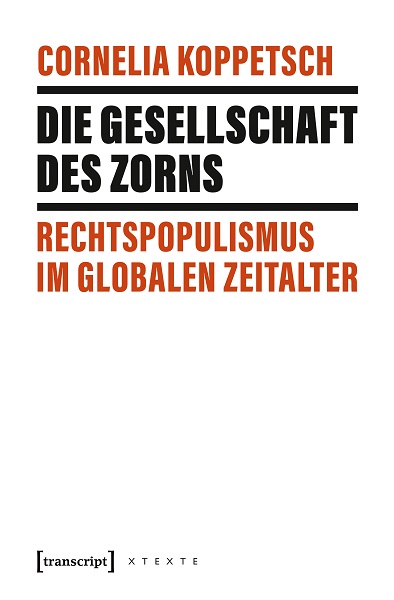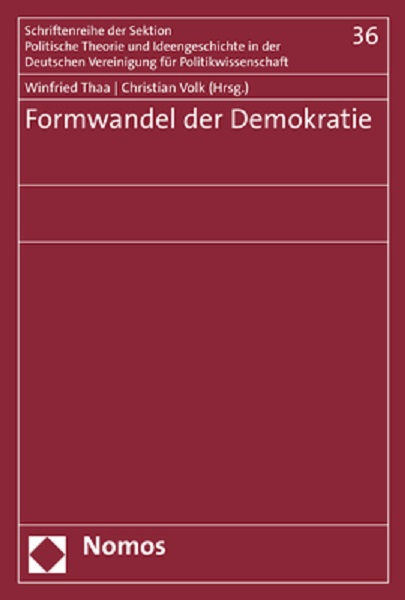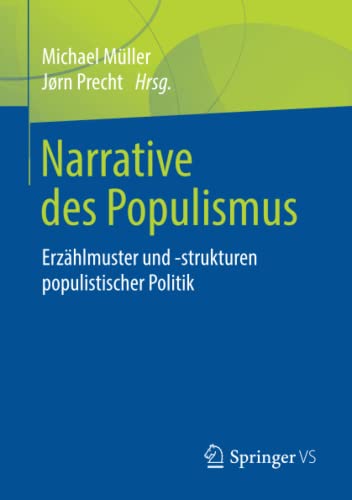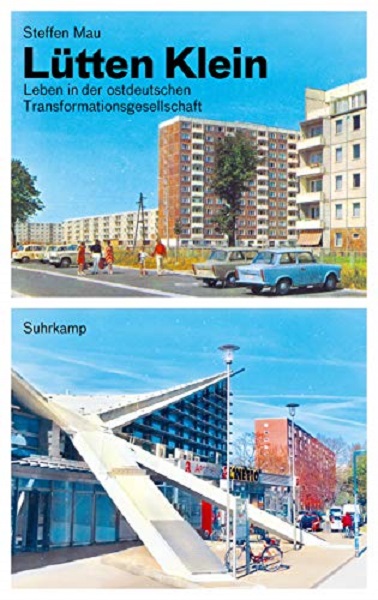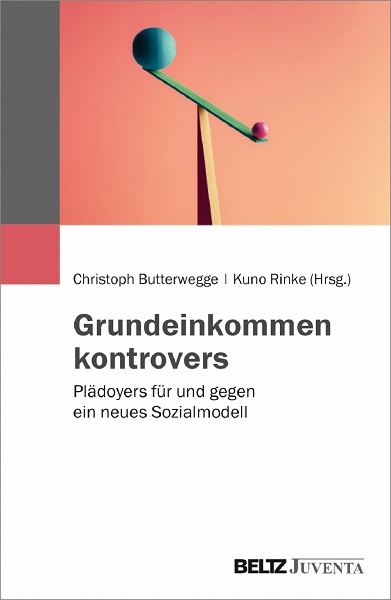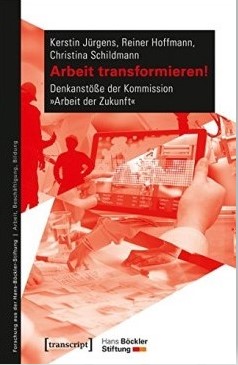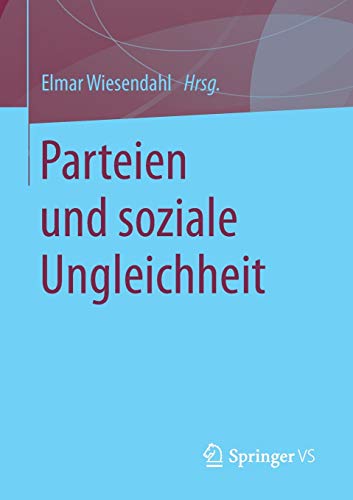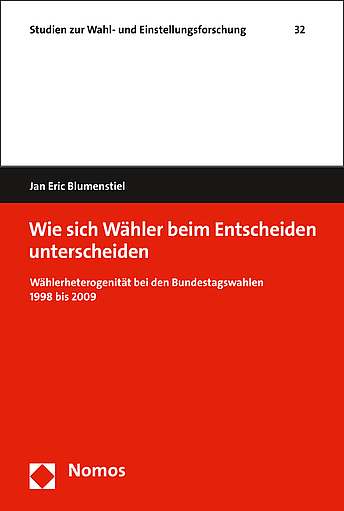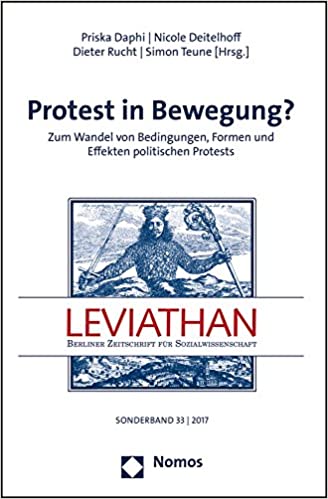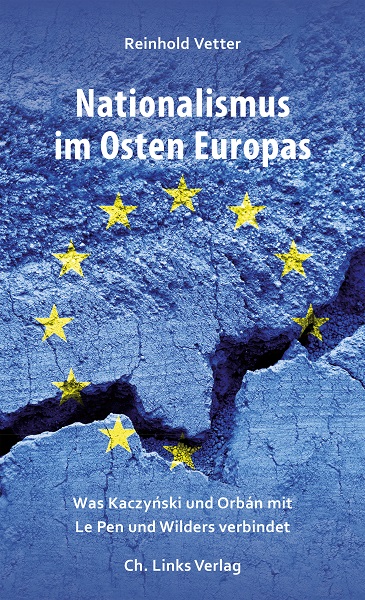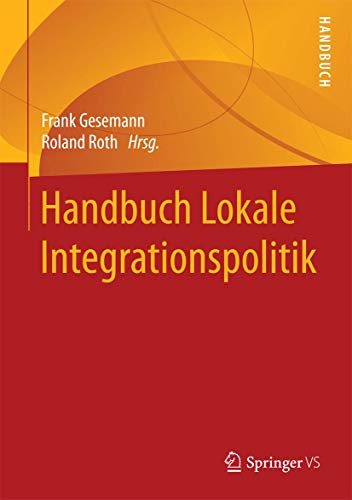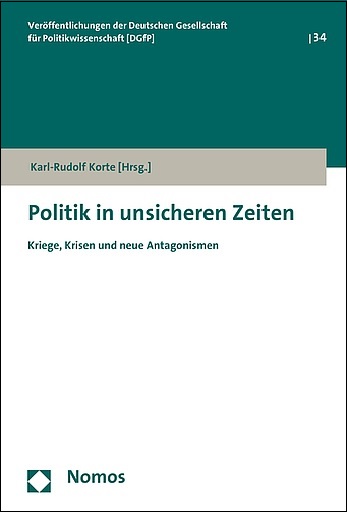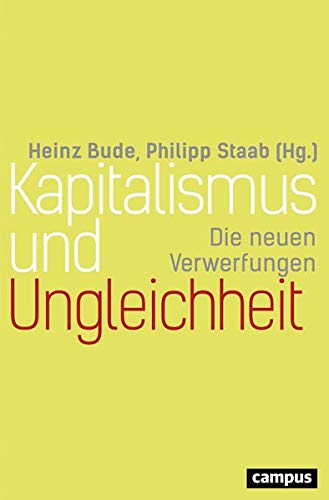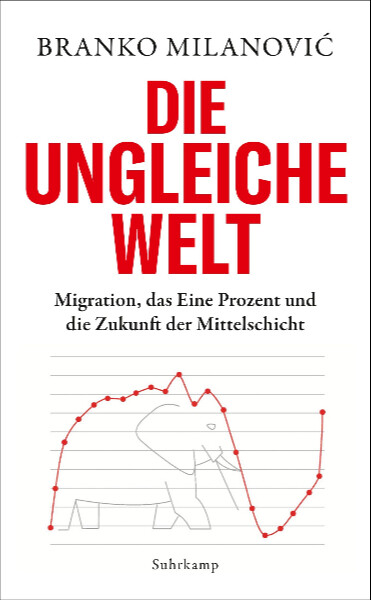Wendy Brown: Nihilistische Zeiten. Denken mit Max Weber
Die politische Theoretikerin Wendy Brown hat sich mit Max Weber einen sozialwissenschaftlichen Klassiker vorgenommen, den sie für die kritische Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft anschlussfähig macht, wie Thomas Mirbach in seiner Rezension darlegt. Insbesondere in Webers Konzeption des besonderen Verhältnisses der Sphären von Politik und Wissenschaft sehe Brown eine Inspirationsquelle zur Auseinandersetzung mit jenen nihilistischen Tendenzen, die sowohl zu Zeiten Webers als auch heute eine politische Herausforderung darstellen.
Georg Wenzelburger, Reimut Zohlnhöfer: Handbuch Policy-Forschung
Mit der zweiten, überarbeiteten und erweiterten Auflage des „Handbuch[s] Policy-Forschung“ ist es den Herausgebern und Mitwirkenden gelungen, einen guten Überblick über das Profil eines Forschungsfeldes zu geben, resümiert unser Rezensent Thomas Mirbach. Dabei regt er an, die Entscheidung zu überdenken, ob die Fokussierung dieses Forschungsfeldes auf kausale Erklärungen bei Ausschluss von anwendungsbezogenen Perspektiven so beibehalten werden sollte und stellt die Frage in den Raum, ob die Policy-Forschung nicht auch eine Beratungsfunktion entfalten könnte.
Adrian Daub: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst
In seinem gleichnamigen Buch über die „Cancel Culture" untersucht Adrian Daub, wie der Begriff in den Medien konstruiert wird und vertritt die These, dass dieser Konstruktion eine „moralische Panik“ zugrunde liege. Unserem Rezensenten Thomas Mirbach erscheint die Einordnung dieser Meinungsbeiträge als Versuche einer Verteidigung von Privilegien plausibel. Dass Daub dabei den Begriff vor allem mit deutschen Feuilleton-Debatten in Verbindung bringt, ist Mirbach zufolge jedoch ebenso wenig überzeugend, wie die Engführung der Kritik von Privilegien auf die „Schreibenden“.
Volker M. Heins, Frank Wolff: Hinter Mauern. Geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft
Volker M. Heins und Frank Wolff fügen den Forschungsdebatten um die sozialen Folgen von Migration in Europa eine neue Perspektive hinzu: Nicht die Auswirkungen der Migration selbst, sondern die des Grenzregimes werden von den Autoren kritisch beleuchtet, da sie in Kombination mit einer Verschiebung des politischen Gefüges nach rechts eine Gefahr für die liberale Demokratie darstellen würden. Thomas Mirbach begrüßt in seiner Rezension die Perspektivumkehr der Studie, merkt jedoch an, dass der Erklärungsansatz der Autoren der Komplexität des Gegenstands nicht ganz gerecht werde.
Arjun Appadurai, Neta Alexander: Versagen. Scheitern im Neoliberalismus
Arjun Appadurai und Neta Alexander versuchen eine Kritik der neoliberalen Individualisierung ökonomischen Scheiterns im Begriff des „Versagens“ auf den Punkt zu bringen und im Kontext der neuesten Entwicklungen in der digitalisierten Wirtschaftswelt zu analysieren – von der Wall Street bis zum Silicon Valley. Unser Rezensent Thomas Mirbach ist von ihrer Diagnose nicht vollends überzeugt, spricht den Autor*innen aber zu, mit der „Veralltäglichung des verdeckten und systemimmanenten Versagens“ ein zentrales Problem identifiziert zu haben.
Alexandra Schauer: Mensch ohne Welt. Eine Soziologie spätmoderner Vergesellschaftung
In ihrer preisgekrönten Dissertation „Mensch ohne Welt“ rekonstruiert die Soziologin Alexandra Schauer die historischen Entwicklungen des menschlichen „Weltverhältnisses“ im Rahmen der Genese und Ablösung der Epoche der Moderne durch die Spätmoderne. In der laut unserem Rezensenten Thomas Mirbach beeindruckenden Studie zeigt Schauer einen allgemeinen Niedergang von Öffentlichkeit beim Übergang zur Spätmoderne auf, der mit dem Verlust der Wahrnehmung des Menschen einhergehe, die Welt auch nach seinen Vorstellungen gestalten zu können.
Raymond Geuss: Über die Arbeit. Ein Essay
Die Arbeitswelt ist im Zuge der Digitalisierung einem epochalen Wandel unterworfen. Der Philosoph Raymond Geuss hat sich nun, wie unser Rezensent Thomas Mirbach herausstellt, grundlegend mit dem Begriff der Arbeit auseinandergesetzt: Angereichert mit biographischen Einschüben gehe Geuss insbesondere der Frage nach, was unser Verständnis gesellschaftlicher Arbeit – und ihrer Kritik – bisher ausgemacht hat und zeige nicht zuletzt auf, auf welche derzeitigen problematischen Entwicklungen die Arbeitswelt zukünftig sensibilisiert werden müsse.
Byung-Chul Han: Die Krise der Narration
Narrative scheinen allgegenwärtig. Byung-Chul Han argumentiert hingegen, dass sie an Bedeutung eingebüßt haben. Sein Begriff des Narrativs zielt auf intersubjektiv geteilte, integrative Erzählungen. Diese gerieten durch Veränderungen der Öffentlichkeit (Stichwort: soziale Medien) unter Druck und würden durch tendenziell narzisstische Akte der Selbstdarstellung ersetzt. Hier setzt auch die Einschätzung unseres Rezensenten an, der im Buch mehr als ein „Klagen über den Gemeinschaftsverlust“ erblickt – mit handfesten politischen Auswirkungen.
Ruud Koopmans: Die Asyl-Lotterie. Eine Bilanz der Flüchtlingspolitik von 2015 bis zum Ukraine-Krieg
Anhand zahlreicher empirischer Befunde kritisiert Ruud Koopmans die Defizite der bisherigen europäischen Asylpolitik, die seiner Ansicht nach die Integration erschwere, Europa von Autokraten abhängig mache und für den Tod tausender Geflüchteter verantwortlich sei. Stattdessen plädiert er für eine realistische Reform, die auf humanitären Kontingenten statt individuellem Asylrecht, der Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten und konsequenten Abschiebungen basiert. Thomas Mirbach teilt Koopmanns Problembeschreibung, stellt aber seine Lösungsvorschläge in Frage.
Nancy Fraser: Der Allesfresser. Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt
In ihrem Buch „Der Allesfresser“ behandelt Nancy Fraser den "kannibalischen Kapitalismus". Sie beschreibt ihn als eine „institutionalisierte Fressorgie“, die in ihrer Existenz von nicht-ökonomischen Bedingungen wie Geschlecht, ’Rasse’, Ökologie und politischer Macht abhängt und sich ihre Grundlagen auf selbstzerstörerische Weise einverleibt. Thomas Mirbach lobt, dass Fraser verschiedene kritische Perspektiven zusammenführt, hält aber den Anspruch, mit der Kannibalismus-Metapher einen neuen Ansatz zur Analyse kapitalistischer Vergesellschaftung vorgelegt zu haben, für zu hoch gegriffen.
Axel Honneth: Der arbeitende Souverän. Eine normative Theorie der Arbeit
Axel Honneth möchte einen „blinden Fleck“ gegenwärtiger Demokratietheorien ausleuchten, indem er die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse auf ihre Demokratieverträglichkeit hin untersucht. Um „den Abstand zwischen politischer Demokratie und sozialer Arbeitsteilung so klein wie möglich werden zu lassen“, entwickelt er auf der Grundlage eines erweiterten Arbeitsbegriffs und Überlegungen zur gesellschaftlichen Funktion der Arbeitsteilung einen neuen theoretischen Rahmen. Darüber hinaus diskutiert Honneth Möglichkeiten, auf welchem Wege eine Demokratisierung der Arbeit gelingen kann.
César Rendueles: Gegen Chancengleichheit. Ein egalitaristisches Pamphlet
Chancengleichheit sei nicht nur ein Mythos, sondern trage auch dazu bei, Ungleichheiten zu rechtfertigen, schreibt der Soziologieprofessor César Rendueles. Stattdessen plädiert er für einen Egalitarismus, der Gleichheit als politisches Ziel und nicht als Ausgangspunkt begreift. Dies bedeute beispielsweise Bildung nicht als Instrument zur Herstellung von Gleichheit, sondern Gleichheit als Voraussetzung für bestmögliche Bildung zu verstehen. Eine gelungene Auseinandersetzung mit den Ohnmachtserfahrungen vieler Menschen angesichts neoliberaler Ökonomisierung, lobt Thomas Mirbach.
Thomas Piketty: Eine kurze Geschichte der Gleichheit
120.000 Euro zum 25. Geburtstag – eine Maßnahme, die laut dem französischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty zu mehr Gleichheit führen könnte. In seinem neuesten Buch argumentiert Piketty, dass die Ungleichheit seit dem späten 18. Jahrhundert abgenommen habe, jedoch immer noch ein dringendes Problem darstellt, das durch eine starke Sozialpolitik und progressive Besteuerung bekämpft werden könne. Thomas Mirbach lobt in dieser Rezension die gut lesbare Art, in der Piketty wesentliche Faktoren der Ungleichheitsentwicklung vermittelt.
Florian Grotz: Neue Welt – andere Politik? Politikwissenschaftliche Vermessungsversuche
Dieses Buch entstand im Nachgang zur 2021 stattgefunden 38. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP). Fokus waren die Effekte multipler Krisen, die die Rahmenbedingungen politischen Handelns in der letzten Dekade nachhaltig umformten, darunter digitale Transformation, Klimawandel, Autoritarismus, Populismus und die Krise des Multilateralismus. Thomas Mirbach folgert in seinem Resümee zur Lektüre, dass sich zu „bereichsübergreifende[n] Vermessungsversuche[n]“ neuer Politik auch der Blick auf die Politische Soziologie lohne.
Christian Lammert, Boris Vormann: Das Versprechen der Gleichheit. Legitimation und die Grenzen der Demokratie
Rezensent Thomas Mirbach hält das Buch „Das Versprechen der Gleichheit“ von Christian Lammert und Boris Vormann für eine „sehr anregende Studie“ zum Thema „Krise der Demokratie“. Sowohl der konzeptionelle Ansatz – auf spezifische Verschränkungen des gesellschaftlichen ‚Innen’ und ‚Außen’ zu achten – als auch die Destruktion des egalitären und anti-kolonialen Gründungsmythos der US-amerikanischen Demokratie seien Stärken dieser Publikation, schreibt Mirbach. Ebenso hervorzuheben sei die Integration rassismus- und diskriminierungskritischer Perspektiven in die Analyse des gesellschaftlichen ‚Wir’ als Basis von Gleichheitsversprechen.
Werner Rätz / Dagmar Paternoga / Jörg Reiners / Gernot Reipen (Hrsg.): Digitalisierung? Grundeinkommen!
Das Grundeinkommen wird längst nicht mehr als rein einkommensbezogenes Instrument betrachtet. Das Spektrum der Grundeinkommensbewegung, vorliegend durch unterschiedliche Beiträge von zu Wort kommenden Wissenschaftler*innen, Parteivertreter*innen und Aktivist*innen repräsentiert, sieht darin einen Baustein zur umfassenden Stärkung der Gemeinwohlökonomie. Für Thomas Mirbach ist dies ein Zeichen dafür, dass die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens längst zur analytischen Blaupause für strukturelle Defizite einer kapitalistisch organisierten Arbeitsgesellschaft avanciert ist.
Branko Milanović: Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht
Branko Milanović hat nach Meinung von Thomas Mirbach mit seiner Studie „Kapitalismus global“ einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung globaler post-demokratischer Tendenzen vorgelegt. Vor allem seine empirischen Analysen des Zusammenwirkens kapitalismusspezifischer Strukturentwicklungen – wachsende Einkommensungleichheiten, Abkoppelungen von Eliten, steigende Korruption – seien von Relevanz für die Fachdiskussion. Dass der Autor sich zur Erläuterung seines Demokratieverständnisses auf ‚realistische’ Spielarten der Konkurrenzdemokratie (Joseph Schumpeter) beziehe, hält Mirbach für ein Manko, beeinträchtige aber nicht die empirischen Befunde dieser Publikation.
Jahrbuch „Extremismus & Demokratie" 2019 und 2020. Bewährtes Forum der vergleichenden Extremismusforschung
Rezensent Thomas Mirbach widmet sich zwei Ausgaben des Jahrbuches „Extremismus & Demokratie". Für die des Jahres 2019 werde angesichts des Inkrafttretens der Weimarer Reichsverfassung ein vergleichender Blick auf die erste und zweite deutsche Demokratie geworfen und gefragt, inwieweit Strukturschwächen der Verfassung zum Zusammenbruch der Republik geführt haben. Bei den Analysen des Bandes für das Jahr 2020 dominierten Partialstudien. Zwar stellten die Jahrbücher ein bewährtes Forum für die vergleichende Extremismusforschung dar, doch sollten sie, so Mirbach, stärker für neuere sozialwissenschaftliche Konzepte geöffnet werden. (ste)
Wilhelm Heitmeyer / Manuela Freiheit / Peter Sitzer: Rechte Bedrohungsallianzen. Signaturen der Bedrohung II
Die Reichweite rechter Bedrohungen habe sich deutlich vergrößert, so der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer in der gemeinsam mit Manuela Freiheit und Peter Sitzer publizierten Studie, die die 2018 erschienene Untersuchung „Autoritäre Versuchungen“ fortschreibt. „Ihre Akteure sind mittlerweile bis in die Strukturen und Institutionen der demokratischen Kultur vorgedrungen.“ Diese Entwicklung zeige sich exemplarisch am verdeckten Eindringen in Sicherheitsinstitutionen wie Polizei, Bundeswehr und Verfassungsschutz. Im Kampf um eine kulturelle Hegemonie überlagerten sich neo-rassistische und antisemitische Elemente, so Rezensent Thomas Mirbach.
Adam Przeworski: Krisen der Demokratie
Was gegenwärtig als Krise der Demokratie diskutiert werde, habe „‚tiefe ökonomische und gesellschaftliche Wurzeln‘“, heißt es in der Studie des Politikwissenschaftlers Adam Przeworski. Dazu zähle der Autor einerseits, wie Rezensent Thomas Mirbach ausführt, die steigende ökonomische Ungleichheit, verstärkt durch die abnehmende Bedeutung der Gewerkschaften, und die Deregulierung der Finanzmärkte. Andererseits sehe Przeworski auf der institutionellen Ebene die Erosion der traditionellen Parteiensysteme und das Erstarken von nationalistischen Parteien als dramatische Entwicklungen an. Gefährdet seien Demokratien auch durch eine graduelle Dekonsolidierung ihrer Institutionen und Normen.
Claudia Wiesner / Philipp Harfst (Hrsg.): Legitimität und Legitimation. Vergleichende Perspektiven
Der Band zeige die Breite der Debatte der empirischen Legitimitätsforschung und verdeutliche zugleich Desiderate künftiger Studien, so Rezensent Thomas Mirbach. Dazu gehöre der in den Beiträgen unterschiedlich angelegte Zusammenhang von normativen und empirischen Argumenten in der Bestimmung von Legitimität. Deutlich werde auch die in der Umfrageforschung zu beobachtende methodische Engführung von Fragen der Legitimität auf solche der Akzeptanz. Insgesamt unterstreiche der Band die Mehrdimensionalität von Legitimitätsansprüchen und -urteilen, die sinnvoll nur in Kombination unterschiedlicher methodologischer Ansätze untersucht werden könne.
Populismus, Radikalisierung, Autoritarismus. Herausforderungen der Demokratie

Unterschiedliche Facetten der Gefährdung von Demokratie stehen im Blickpunkt von drei Sammelbänden, denen sich Thomas Mirbach widmet. Der von Ralf Mayer und Alfred Schäfer edierte Band betrachte die Debatte über den Populismus aus divergierenden Perspektiven. Um Radikalisierungsprozesse gehe es in dem von Christopher Daase et al. herausgegebenen Buch und im Band „Die Zukunft der Demokratie“ werden Belastungen für die Demokratie genannt, wie etwa die steigende wirtschaftliche und soziale Ungleichheit und daraus Forderungen zur Rückgewinnung demokratischer Legitimität abgeleitet, so der Rezensent.
Malene Gürgen / Patricia Hecht / Nina Horaczek / Christian Jakob / Sabine am Orde: Angriff auf Europa. Die Internationale des Rechtspopulismus
Der Rechercheverbund „Europe's Far Right“ befasst sich mit den Strategien und Netzwerken der Rechten in Europa. Als ein Ergebnis dieser gemeinsamen Recherchearbeiten liegt mit dieser Publikation nun eine anschauliche Beschreibung von Personen und Hintergründen der „Internationale des Rechtspopulismus“ vor, meint Rezensent Thomas Mirbach. Dargestellt werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede rechtspopulistischer Parteien in Deutschland, Österreich, Ungarn, Polen, Frankreich, Italien und der Schweiz. Insgesamt entstehe ein informatives Bild der Operationsweisen dieser Parteien.
Armin Nassehi: Das große Nein. Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests
Armin Nassehi entwirft eine kultursoziologische Phänomenologie des Protestes, die keine Kritik am Protest beabsichtigt, sondern ihn – als soziale Tatsache – in seinem performativen Sinn und seiner Funktion bestimmt. Dafür entwickelt Nassehi einerseits eine Deutung gesellschaftlicher Folgen digitalisierter Kommunikation und stellt andererseits Spezifika der Protestkommunikation heraus. Das Internet ermögliche eine niedrigschwellige Form des Neins, sodass sich Protestkommunikation „im Netz technisch verstärken und verbreiten“ könne. Soziale Netzwerke stellten daher ein genuines Protestmedium dar.
Philip Manow: (Ent-)Demokratisierung der Demokratie
Der gegenwärtige Populismus sei durch die widersprüchliche Gleichzeitigkeit von zwei Entwicklungen geprägt, die Philip Manow als Demokratisierung und Entdemokratisierung der Demokratie bezeichnet. Zu beobachten sei eine Krise der Repräsentation, nicht aber der Demokratie. Erstere sei eine Konsequenz der Ausweitung politischer Partizipationschancen, weshalb die Demokratie zwar „demokratischer“ geworden sei. Die Krise der Repräsentation transformiere aber den Streit in der Demokratie zu einem über die Demokratie. So würden „Dynamiken der ‚Feindschaft’“ freigesetzt und der Gleichheitsanspruch der Demokratie als zentrale Prämisse des friedlichen politischen Konflikts untergraben. Populisten seien Folge und nicht Ursache des Problems der repräsentativen Demokratie.
Martha Nussbaum: Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise
Der Wahlsieg von Donald Trump 2016 war der Auslöser für Martha Nussbaums Buch, denn – so ihre Wahrnehmung – die Gesellschaft der USA sei von einer vielgestaltigen Angst durchdrungen. Die Autorin befasst sich mit dem Zusammenhang von Angst und anderen Emotionen wie Wut, Ekel und Neid. Eine differenzierte Analyse der sozialen Voraussetzungen einer politischen Mobilisierung von Emotionen wird nicht geboten, wie Thomas Mirbach festhält. Vielmehr entwickelt Nussbaum eine ideengeschichtlich gestützte Phänomenologie basaler Emotionen, die destruktive Effekte für die Demokratie entwickeln können.
Cornelia Koppetsch: Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter
Thomas Mirbach hält den Versuch von Cornelia Koppetsch, „‚sich einen soziologischen Reim auf den Aufstieg der neuen populistischen Rechtsparteien zu machen‘“ für profiliert. Sie deutet den Aufstieg des Rechtspopulismus als „‚eine aus unterschiedlichen Quellen gespeiste Konterrevolution gegen die Folgen der […] Globalisierungs- und Transnationalisierungsprozesse“. Hinter dem Aufstieg von rechten Bewegungen stünden nicht nur (strukturelle) Ursachen, die sich aus einer Beobachterperspektive erschließen lassen, sondern auch Gründe von Akteuren, denen ein Erleben von Deklassierung zugrunde liegt.
Die Bundestagswahl 2017. Ein zwiespältiges Bild?

Die beiden Sammelbände zur Bundestagswahl 2017 von Sigrid Roßteutscher et al. sowie Christina Holtz-Bacha bieten eine Fülle von durchaus informativen Einzelstudien über diverse Facetten des Wahlkampfgeschehens. Auffällig erscheint, schreibt Thomas Mirbach, dass die Beiträge – trotz aller Unterschiede hinsichtlich verwendeter Daten und methodischer Ansätze – auf die Frage, ob beharrende oder polarisierende Effekte überwogen, doch eine sehr ähnliche Antwort geben: Die vielfach vermuteten Tendenzen der Polarisierung zeichneten sich in den erhobenen Daten nicht ab.
Jutta Allmendiger / Jan Wetzel: Die Vertrauensfrage – Für eine neue Politik des Zusammenhalts
In diesem Essay greifen Jutta Allmendinger und Jan Wetzel Befunde einer von der Wochenzeitung „Die Zeit“, dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung konzipierten Erhebung auf. Nach Meinung des Rezensenten Thomas Mirbach bietet das Autorenduo „anregende Deutungen des Verhältnisses von Selbstbeurteilung und Gesellschaftsbild in Deutschland“. Der übergreifende Interpretationsrahmen – die Vertrauensfrage als Verteilungsfrage – sei plausibel, was auch für die formulierten Vorschläge einer „Politik des Vertrauens“ gelte.
Winfried Thaa / Christian Volk (Hrsg.): Formwandel der Demokratie
Die liberalen repräsentativen Demokratien geben nach Meinung der Herausgeber derzeit „ein durchaus gegensätzliches“ Bild ab, das ebenso autoritäre Tendenzen wie zunehmende Beteiligungsansprüche, vielfältige Protestaktionen und auch ein Experimentieren mit neuen Partizipationsformen aufweist. Die Autor*innen konzentrieren sich primär auf Phänomene eines Formwandels demokratischer Prozeduren und Praktiken. Aus Sicht der Demokratietheorie werden unterschiedliche Zugänge zum Populismus beleuchtet; thematisiert wird auch, was Demokratie jenseits nationalstaatlicher Verfasstheit bedeuten könnte.
Michael Müller / Jørn Precht (Hrsg.): Narrative des Populismus. Erzählmuster und -strukturen populistischer Politik
Die Herausgeber dieses Bandes verstehen Narrative nicht als Geschichten, sondern als semantische Strukturen, die Geschichten oder Diskursen zugrunde liegen und damit eine generelle sinnstiftende Funktion erfüllen. Da die Erzählung von Geschichten in konkreten kommunikativen Kontexten erfolgt, erscheint es zum Verständnis populistischer Strömungen aussichtsreich, in erster Linie diese zugrunde liegenden Narrative zu analysieren. Auch wenn nicht alle Beiträge diesem formalen Zugang folgen, bietet der Band eine Reihe anregender Analysen nicht allein, aber doch vornehmlich rechtspopulistischer Kommunikationen.
Andreas Zick / Beate Küpper / Wilhelm Berghan (Hrsg.): Verlorene Mitte – Feindselige Zustände
Während sich in der Mitte-Studie 2016 das Bild einer ‚gespaltenen‘ Mitte abzeichnete, haben sich zwischen 2016 und 2018 in Deutschland die kollektiven Einstellungen dahingehend verändert, dass nicht mehr nur von einer Fragilität, sondern einem Verlust der Mitte gesprochen werden könne, so das Ergebnis der Untersuchungen der Autoren. Es bestärke sich zwar das Bild „neuer rechter Mentalität als ein völkisch-autoritär-reaktionäres Aufbegehren“, rechtspopulistische Einstellungen verfestigten sich in der Mitte, eindeutig rechtsextreme Positionen werden jedoch mehrheitlich abgelehnt.
Steffen Mau: Lütten Klein – Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft
Steffen Mau beschreibt die ostdeutsche Lebenswelt. Dabei dient ihm das Rostocker Neubaugebiet Lütten-Klein, das zuletzt gut 40.000 Einwohner umfasste und als ein typisches Projekt der Wohnungspolitik der DDR galt, als „Fenster zur Beobachtung“ des sozialistischen Alltags. Seinen Ausführungen liegt die These „struktureller Brüche im ostdeutschen Entwicklungspfad“ zugrunde. Nach Meinung von Thomas Mirbach präsentiert Mau eine beeindruckende Diagnose, die soziale Deklassierungen und kulturelle Entwertungen herausarbeitet, die die Transformation der früheren DDR bis heute prägen und belasten.
Martin W. Schnell / Christine Dunger (Hrsg.): Digitalisierung der Lebenswelt.
Studien zur Krisis nach Husserl
Manche Debatten über die Folgen der Digitalisierung vermitteln den Eindruck, in der sich abzeichnenden algorithmisch gesteuerten Gesellschaft sei kein Platz mehr für die Idee eines humanistischen Subjekts als primärer Quelle sozialer Ordnung. Von derartigen posthumanistischen Deutungsangeboten unterscheiden sich die Beiträge dieses Sammelbandes deutlich, schreibt Rezensent Thomas Mirbach. Zwar werde Digitalisierung nicht als Prozess beschrieben, der von einer Pro-oder-Contra-Entscheidung abhängt, aber der Umgang mit ihr sollte nicht als Anpassung an die durch die Digitalisierungslogik vorgegebenen Bedingungen erfolgen.
Heiner Flassbeck / Paul Steinhardt: Gescheiterte Globalisierung – Ungleichheit, Geld und die Renaissance des Staates
Der Titel der von Heiner Flassbeck und Paul Steinhardt verfassten Studie könnte täuschen: Die Autoren treffen kein Urteil über das Faktum von Globalisierung, ihnen geht es vielmehr um eine Destruktion zentraler Positionen des Wirtschaftsliberalismus, die weder theoretisch noch praktisch ein angemessenes Verständnis von Voraussetzungen und Folgen der Einbettung nationaler Ökonomien in globale Zusammenhänge ermöglichen. Sie wenden sich gegen eingespielte Dogmen der etablierten Wirtschafts- und Finanzpolitik und plädieren für eine neue, an die Verantwortung des demokratischen Nationalstaates gebundene Ökonomik.
Björn Hacker: Weniger Markt, mehr Politik. Europa rehabilitieren
Björn Hacker will mit seinem Buch den Prozess der europäischen Integration gegenüber zahlreichen Krisendiagnosen linker oder rechter Spielart als zukunftsweisendes Projekt rehabilitieren. Er plädiert für einen reformistischen Realismus, der die Potenziale der bestehenden institutionellen Architektur zumal der Eurozone im Sinne einer „European Politics against global Markets“ nutzt. Hacker setzt sich unter anderem mit wesentlichen Konfliktfeldern europäischer Politik auseinander und entwirft Grundzüge einer europäischen Politikgestaltung.
Christoph Butterwegge / Kuno Rinke (Hrsg.): Grundeinkommen kontrovers. Plädoyers für und gegen ein neues Sozialmodell
Die bereits in den 1980er-Jahren aufgekommene Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) für alle Mitglieder einer politischen Gemeinschaft stößt seit einiger Zeit wieder auf mehr Aufmerksamkeit in der politischen Debatte. Aber nach wie vor firmiert unter dem Etikett BGE sehr Unterschiedliches. Nicht nur die Heterogenität der Positionen, sondern der oftmals auch sehr polemische, zwischen instrumentellen Überlegungen und unterschiedlichen Wertprämissen changierende Debattenstil erschwert die Orientierung. Christoph Butterwegge und Kuno Rinke haben jeweils sechs Plädoyers für und gegen ein BGE zusammengetragen, um eine Urteilsbildung zu erleichtern.
Wilhelm Heitmeyer: Autoritäre Versuchungen. Signaturen der Bedrohung 1
Mit dem komplexen Zusammenhang von Integrations- und Desintegrationsprozessen in modernen Gesellschaften hat sich Wilhelm Heitmeyer intensiv befasst. Insbesondere die Verbreitung und Ausprägungen rechtsextremistischer Einstellungen in Deutschland waren Gegenstand des von ihm koordinierten empirischen Langzeitprojektes „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, dessen Befunde in der zehnbändigen Buchreihe „Deutsche Zustände“ publiziert wurden. Mit seiner aktuellen Studie schreibt Heitmeyer diese Analysen über Verarbeitungen und Folgen der ökonomischen, sozialen und politischen Krisen bis einschließlich 2017 fort, um damit das Spezifische der heutigen politischen Konstellation gegenüber der Situation der 2000er-Jahre herauszuarbeiten.
Armut und das Epizentrum der sozialen Frage. Über die Wiederkehr gesellschaftlicher Konflikte

Wie wird über Armut kommuniziert? Ausgehend vom aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung erörtert Thomas Mirbach, welche Bilder von Armut darin entworfen werden und wie sich die Perspektiven im Laufe der Berichterstattung gewandelt haben. Er verweist dabei auch auf die immanenten Grenzen eines ministeriellen Berichts und legt dar, welche Fragen und Problemlagen ausgespart oder vernachlässigt werden. Im Kern mangele es dem Bericht an einer Auseinandersetzung mit dem Wandel des Arbeitsmarktes und den strukturellen Zusammenhängen sozialer Ungleichheit.
Kerstin Jürgens / Reiner Hoffmann / Christina Schildmann: Arbeit transformieren! Denkanstöße der Kommission „Arbeit der Zukunft“
Das Beschäftigungsmodell in Deutschland wird durch den digitalen Kapitalismus institutionell und kulturell herausfordert. Eine Kommission der Hans-Böckler-Stiftung hat daher nach der „Arbeit der Zukunft“ gefragt und dabei auf verschiedene Problemfelder geblickt. Als das übergreifende Bezugsproblem einer Transformation der Arbeit wird dabei die soziale Ungleichheit deutlich. Diskutiert werden daher Handlungsansätze, die dem Staat bei der Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft eine Schlüsselrolle zuweisen und für die Gewerkschaften einen stärkeren Einfluss auf die digitale Arbeitswelt fordern.
Elmar Wiesendahl (Hrsg.): Parteien und soziale Ungleichheit
Während die Wahlforschung schon seit Längerem eine zunehmende Asymmetrie von Wahlbeteiligung und Schichtzugehörigkeit beobachtet, hat die Parteienforschung den Zusammenhang von Parteiensystem und sozialer Ungleichheit bisher eher vernachlässigt. Der von Elmar Wiesendahl herausgegebene Sammelband rückt diese Beziehung nun ins Zentrum. Im Vordergrund steht die empirische Darstellung von ungleichheitsbedingten Defiziten der Repräsentation der im Bundestag vertretenen Parteien (ohne AfD). Darüber hinaus werden Überlegungen zu möglichen Erklärungsansätzen angestellt.
Migration und der „nationale Container“. Über einen konflikthaften Diskurs und symbolische Grenzziehungen

Vorgestellt werden Bücher, die eine gestiegene Sensibilität gegenüber gesellschaftlichen Kommunikationsformen belegen, in und mit denen die Themen Migration und Integration verhandelt werden. Deutlich wird dabei nicht nur der konflikthafte Charakter dieser Aushandlungen, in denen sich soziale Kräfteverhältnisse spiegeln. Die neueren Publikationen ermöglichen zum Teil auch erhellende Einsichten in Funktionsweise und Wirkungen symbolischer Grenzziehungen, die in öffentliche Debatten eingelassen sind. Integration wird so nicht länger nur als Anpassung in eine sozial und kulturell eindeutig definierte Mehrheitsgesellschaft gedacht.
Jan Eric Blumenstiel: Wie sich Wähler beim Entscheiden unterscheiden. Wählerheterogenität bei den Bundestagswahlen 1998 bis 2009
In der empirischen Wahlforschung wird mit dem sozialpsychologischen Auswertungsverfahren des Michigan-Modells unterstellt, dass alle Wähler*innen ihre Entscheidung nach derselben Logik treffen, die auf der Abwägung einer begrenzten Anzahl von Kriterien beruht. Jan Eric Blumenstiel prüft diese Annahme der Homogenität und setzt sich methodisch mit der zunehmenden Wählerheterogenität auseinander. Er entwickelt das Michigan-Modell zu einem Stufenmodell der Wahlentscheidung weiter, das Differenzierungen im Wahlverhalten mit den Eigenschaften und Einstellungen der Wähler*innen erklärt.
David Miller: Fremde in unserer Mitte – Politische Philosophie der Einwanderung
David Miller versucht eine dezidiert realistische Perspektive zu begründen, die sich im Rahmen der politischen Philosophie – und nicht der einer politischen Ethik – mit der Frage auseinandersetzt, wie moderne Gesellschaften Einwanderung regulieren könnten, ohne ihre liberaldemokratischen Grundsätze aufzugeben. Die Gegenposition eines starken Kosmopolitismus, der Grenzen moralisch für obsolet hält, bewegt sich für Miller in einer hypothetischen Welt, in der all jene Faktoren nicht existent sind, „die Einwanderung für uns überhaupt erst zu so einer kontroversen Angelegenheit machen“.
Priska Daphi / Nicole Deitelhoff / Dieter Rucht / Simon Teune (Hrsg.): Protest in Bewegung? Zum Wandel von Bedingungen, Formen und Effekten politischen Protests
Es ist eine theoretisch wie empirisch markante Behauptung, mit der die Herausgeberinnen und Herausgeber die thematische Relevanz des Leviathan-Sonderbandes hervorheben: Angesichts abnehmender Nutzung institutioneller Formen politischer Beteiligung finde die Artikulation politischer Belange zunehmend in Form von Protesten statt. In den vorwiegend empirisch-deskriptiven Beiträgen wird aufgezeigt, wie sehr sich die Protestlandschaft in den vergangenen 30 Jahren verändert hat. Die Befunde dieser Zwischenbilanz geben kein kohärentes Gesamtbild ab, vielmehr belegen sie eine zunehmende Heterogenität des Protestgeschehens.
Zwischen normativem Anspruch und politischer Realität. Die Verfahren der direkten Demokratie auf dem Prüfstand

Können Verfahren der direkten Demokratie eine höhere demokratische Dignität für sich beanspruchen als die der repräsentativen Demokratie? Aktuell erhält diese Frage jenseits der politischen Theorie ein besonderes Gewicht, weil zu ihren Befürwortern nicht nur Parteien links der Mitte zählen. Damit liegt die Vermutung nahe, dass es bei den einschlägigen Debatten nicht allein um die Begründbarkeit strittiger institutioneller Regelungen geht. Aber für jenen Bereich des Streites, der für empirisch gestützte Argumente zugänglich ist, liegen zwei neuere Publikationen vor, die die Lektüre lohnen.
Repräsentation, sozialer Ausschluss und Beteiligung. Demokratietheoretische Perspektiven

Thomas Mirbach nimmt die Krisenerscheinungen der modernen repräsentativen Demokratie zum Anlass, die theoretische Debatte über Repräsentation, soziale Ungleichheit und Partizipation näher zu beleuchten. Den Ausgangspunkt bildet der von Danny Michelsen und Franz Walter diagnostizierte zweigleisige Prozess einer Entdemokratisierung und zugleich einer Entpolitisierung. Die mit diesem widersprüchlichen Zusammenhang angesprochenen begrifflichen und normativen Fragen werden anhand ausgewählter Positionen aufgegriffen und differenziert erörtert.
Zuwanderung, Flucht, Integration. Ein etabliertes Forschungsfeld und neue Fragen

Auf die politischen, administrativen und sozialen Herausforderungen der Zuwanderung nach Deutschland hat die hiesige Forschung bemerkenswert schnell reagiert, schreibt Thomas Mirbach. Anhand von sieben Publikationen lässt sich zeigen, dass nicht länger auf eine Assimilation an Standards der Mehrheitsgesellschaft gesetzt wird. Zwar existieren weiterhin Mechanismen struktureller Diskriminierung, aber das Modell einer kulturell homogenen Gesellschaft hat sich als Fiktion erwiesen. Positive Erfahrungen mit Integration werden momentan vor allem auf der kommunalen Ebene gesammelt.
Befindlichkeiten der „nervösen Mitte“. Systemkritik, Extremismus, Menschenfeindlichkeit?

ittelklasse, Mittelschicht, gesellschaftliche Mitte – drei Begriffe sind im Umlauf, um jene höchst heterogene, soziologisch schwer fassbare gesellschaftliche Lage zwischen Ober- und Unterschicht zu benennen. Der Blick auf diese „Mitte der Gesellschaft“ hat auffällig an Aufmerksamkeit gewonnen. Führen Deregulierungen des Arbeitsmarktes, zunehmende Individualisierung von Erwerbsrisiken und nur schwer zu steuernde Zuwanderungsprozesse zu einer Destabilisierung dieser bisher eher als gesichert geltenden sozialen Lagen? Sind auch Angehörige der Mittelschicht angesichts einer sich verschärfenden Ungleichheit der Gesellschaft zunehmend von Abstiegsprozessen bedroht und macht sie das anfälliger für Einstellungen, die von den bisher geltenden Standards demokratischen Interessenausgleichs abrücken?
Reinhold Vetter: Nationalismus im Osten Europas. Was Kaczynski und Orbán mit Le Pen und Wilders verbindet
In Europa zeigt sich ein Nationalismus, der aus ideologischen Versatzstücken zusammengesetzt ist, dazu zählen Glorifizierungen von nationaler Homogenität, Traditionswerten und partikularen Leitkulturen einerseits und andererseits die Abwehr alles Fremden, sei es in Gestalt von Flüchtlingen, sei es in Gestalt eines kulturellen oder religiösen Pluralismus. Der Publizist Reinhold Vetter fragt nach den Gründen dieser nationalistischen Strömungen insbesondere in den ost- und mitteleuropäischen Staaten, ins Zentrum seiner Analyse stellt er die nationalkonservativen, populistischen und rechtsradikalen Parteien, die regieren und damit über politische Gestaltungsmacht verfügen.
Frank Gesemann / Roland Roth (Hrsg.): Handbuch Lokale Integrationspolitik. In den Kommunen wird die Einwanderung gemeistert
Das Handbuch löst den Anspruch einer umfassenden Behandlung kommunaler Integrationspolitik in den jeweiligen Facetten und Rahmungen gut ein. Gerade die Vielfalt der eingenommenen Perspektiven – dem Prinzip zunehmender Konkretion folgend – belegt überzeugend die in den vergangenen rund zehn Jahren erfolgte konzeptionelle Ausdifferenzierung und Professionalisierung des Handlungsfeldes auf kommunaler Ebene. Auch das kann man den Beiträgen entnehmen: Die allmähliche Abkehr von der Position, Deutschland sei kein Einwanderungsland, vollzieht sich konkret in den Kommunen.
Karl-Rudolf Korte (Hrsg.): Politik in unsicheren Zeiten. Kriege, Krisen und neue Antagonismen
In der Einleitung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes skizziert Karl-Rudolf Korte die Herausforderung, die die Globalisierung für Deutschland darstellt, und rückt die Folgen steigender Verschiedenheit der Gesellschaft in den Mittelpunkt. Dass der Globalisierungsschub die Qualität unserer Demokratie verändert, hält er für sicher – offen sei jedoch, in welche Richtung. In den Beiträgen werden Perspektiven der sozialwissenschaftlichen Thematisierung von Globalisierungsfolgen aufgezeigt, Unsicherheiten im außenpolitischen Handeln benannt und die Schwierigkeiten bei der politischen Entscheidungsfindung herausgearbeitet.
Heinz Bude / Philipp Staab (Hrsg.): Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuen Verwerfungen
Im Horizont der gegenwärtigen Transformationen des Kapitalismus werden in dem Heinz Bude und Philipp Staab publizierten Band neue Antworten auf die alten Fragen nach Ursachen und Legitimierungen sozialer Ungleichheit gesucht. In den Blick geraten so Veränderungen der Wertschöpfungsstrukturen, insbesondere im digitalen Kapitalismus, und damit die globale Dimension der Ungleichheit.
Branko Milanović: Die ungleiche Welt. Migration, das Eine Prozent und die Zukunft der Mittelschicht
Die Studie von Branko Milanović beeindruckt durch die souveräne Beherrschung der Daten, die (auf der Basis von über 600 Erhebungen zwischen 1988 und 2011 in 120 Ländern) das Haushaltseinkommen von rund 90 Prozent der Weltbevölkerung abbilden. Darüber hinaus überrascht, dass ein Ökonom – geleitet von der Aussagekraft der verfügbaren Empirie – zur intensiven Diskussion von Fragen anregt, die eigentlich zum Themenkanon der Politikwissenschaft gehören: Er belegt eindringlich, dass Einkommensungleichheit heute nicht länger nur als nationales Phänomen diskutiert werden kann.
Claus Offe: Europa in der Falle
Claus Offe kritisiert die von der Troika auferlegte Strategie der Austerität gegenüber den hoch verschuldeten Ländern Südeuropas. Diese habe Wachstum und Beschäftigung abgedrosselt und die „am meisten verwundbaren Gruppen [...] dem Marktgeschehen“ ausgesetzt. Es sei nicht nur eine Kluft innerhalb Europas deutlich geworden, sondern auch eine Stärkung des Intergouvernementalismus sowie die Entdemokratisierung der Union befördert worden. Er entwickelt ein Modell des demokratischen Kapitalismus in der EU und hält eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik für erforderlich.