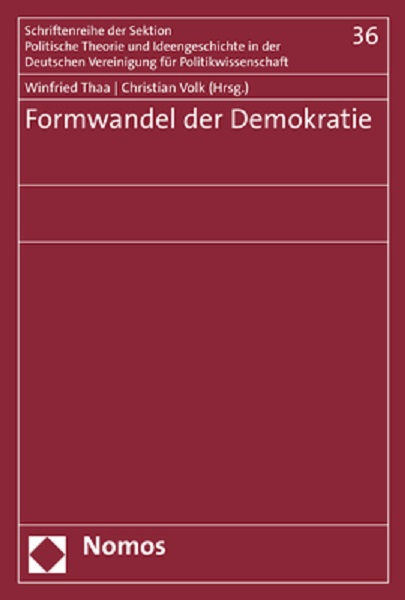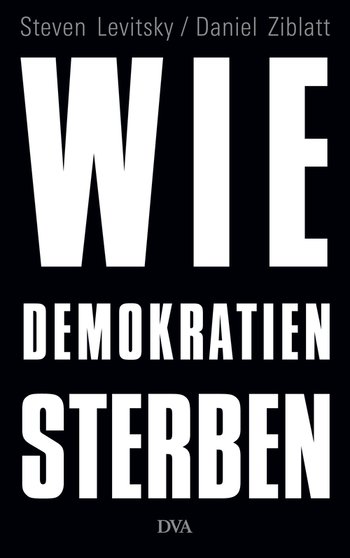Winfried Thaa / Christian Volk (Hrsg.): Formwandel der Demokratie
21.02.2020Mit Blick auf Publikationen einschlägiger Verlage ließe sich ohne große Übertreibung sagen, Abhandlungen zum Thema Demokratiekrise stellten mittlerweile eine eigene Literaturgattung im Segment sozialwissenschaftlicher Zeitdiagnosen dar. Von dieser – nicht zuletzt durch die breite Rezeption der Postdemokratiethese von Colin Crouch geförderten – Krisenfokussierung grenzt sich dieser Sammelband bewusst ab. Er basiert auf einer 2017 an der Universität Trier durchgeführten Tagung der Sektion für Politische Theorie in der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft.
Zwar ließen sich durchaus erratische Entwicklungen in zahlreichen etablierten Demokratien – der Wahlsieg Trumps, die schließlich erfolgreiche Brexit-Bewegung in Großbritannien oder die Aushöhlung rechtsstaatlicher Standards in einigen osteuropäischen Gesellschaften – nicht ignorieren, aber gegenüber den gängigen Verfallsnarrativen heben die Herausgeber hervor, „dass die liberalen repräsentativen Demokratien derzeit ein durchaus gegensätzliches, zunächst einmal in seiner Komplexität zu rekonstruierendes Bild abgeben“ (9), das ebenso autoritäre Tendenzen wie zunehmende Beteiligungsansprüche, vielfältige Protestaktionen und auch ein Experimentieren mit neuen Partizipationsformen aufweist.
Zur Komplexität der aktuellen Entwicklungen gehört gewiss der Umstand, dass „ganz offensichtlich große Teile der während der letzten Jahrzehnte in den westlichen Demokratien marginalisierten Bevölkerungsgruppen in den politischen Raum“ zurückkehren. Auch wenn dies zunächst überwiegend in Gestalt (rechts-)populistischer Bewegungen geschieht, scheint damit die „Diagnose einer entpolitisierten Epoche der Postdemokratie“ (12) widerlegt zu sein.
Der Fokus der Beiträge richtet sich deshalb primär auf Phänomene eines Formwandels demokratischer Prozeduren und Praktiken, bei denen noch nicht ausgemacht ist, ob sich in ihnen eher eine Aushöhlung oder eine Neuinterpretation demokratischer Prinzipien anzeigt. Da diese Entwicklungen zentrale Kategorien unseres politischen Selbstverständnisses – wie Gleichheit, Pluralität, Repräsentation, Öffentlichkeit – betreffen, reklamieren die Herausgeber in selbstbewusster Abgrenzung von Demoskopie und Regierungslehre die primäre Zuständigkeit der Politischen Theorie (13).
Im ersten der vier Themenblöcke setzen sich die Autor*innen mit unterschiedlichen Aspekten des Formwandels aus Sicht der Demokratietheorie auseinander. Im gegenwärtigen Unbehagen an der Demokratie spiegeln sich für Catherine Colliot-Thélène Reaktionen auf Formen eines Entzugs von Politik, der gleichermaßen in Tendenzen einer neoliberalen Globalisierung wie denen einer expertengestützten Technokratie zum Ausdruck kommt. Die aktuellen Gegenreaktionen – teils Politikabstinenz, teils populistischer Protest – werfen erneut die Frage nach der Vereinbarkeit von Volkssouveränität und Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit auf. Und alle auf dieses Spannungsverhältnis bezogenen institutionellen Arrangements können wir nur nach Maßgabe des eigentlich innovativen Elements moderner Demokratie beurteilen – dem Prinzip der Rechtsgleichheit aller.
Am Beispiel früher zeitdiagnostischer Positionen von Theodor Eschenburg, Werner Weber, Siegfried Landshut, Helmut Schelsky und Jürgen Habermas erinnert Veith Selk durchaus anregend daran, dass spezifische Probleme moderner Demokratien – Verselbstständigung politischer Eliten, Verflachung politischer Programmatik, Informalisierungen von Entscheidungsprozessen – bereits in den späten 1950er-Jahren mit Blick auf die alte Bundesrepublik diskutiert worden sind.
Am Beispiel von Debattenbeiträgen von AfD-Abgeordneten des Thüringer Landtags untersucht André Brodocz den paradoxen Typus eines Krisen-Narrativs, dessen Funktion primär darin besteht, Erwartungen an die demokratische Ordnung zu adressieren, die aufgrund der Struktur des Narrativs selbst systematisch enttäuscht werden.
Können sich derartige Narrative stabilisieren, dann werden (mindestens) Chancen einer konstruktiven Verarbeitung der Enttäuschungen blockiert. Wenn Formwandel der Demokratie bedeutet – so Michel Dormal in kritischer Auseinandersetzung mit Positionen von Pierre Rosanvallon und John Keane –, dass individualisierte digitale Kommunikationspraktiken kollektive Repräsentationsbeziehungen auf Basis struktureller Konfliktlinien ersetzen, dann wird der Begriff politischer Öffentlichkeit entleert und Politik „implizit nach dem Vorbild von Marktmechanismen konzipiert“ (90).
Im Anschluss an Cornelius Castoriades, Claude Lefort und Marcel Gauchet sieht Micha Knuth eine Möglichkeit der Revitalisierung von Politik darin, der zweifachen Funktion von Repräsentation Geltung zu verleihen – nämlich nicht nur die Vielfalt von Gesellschaft abzubilden, sondern zugleich deren zentrale Fragen explizit zum Gegenstand der Debatten zu machen.
Im zweiten Themenblock geht es um unterschiedliche Zugänge der Demokratietheorie zum Phänomen des Populismus. Sehr inspirierend fällt Paula Diehls Analyse der 5-Sterne-Bewegung als eine Art Laboratorium demokratischer Experimente aus. Kennzeichnend für diese Bewegung, die Institutionalisierungen ablehnt, ist der Widerspruch zwischen der auf horizontaler Ebene verfolgten Offenheit für informelle Beteiligung und den stets präsenten Interventionsmöglichkeiten seitens der in Beppe Grillo verkörperten Führung. Angesichts dieser Konstellation strikter Abgrenzung zur institutionell vermittelten Politik bleibt abzuwarten, ob und wie bei der von der M5S proklamierten Mischung direkter, partizipativer und beratender Demokratie die Zentralität der personalisierten Führung vermieden wird.
Claudia Landwehr plädiert entschieden für eine engere Zusammenarbeit von normativer politischer Theorie und empirischer Demokratieforschung, denn die vielfach aus primär theoretischer Perspektive aufgestellten Diagnosen technokratischer beziehungsweise populistischer Deformationen aktueller Demokratie seien voreilig, solange nicht empirisch zwischen Angebots- und Nachfrageseite differenziert werde. Aus den verfügbaren Befunden der empirischen Forschung ließen sich allenfalls auf der Nachfrageseite – also gegebenen Einstellungen und Erwartungen – gewisse Bereitschaften für technokratische oder populistische Angebote erkennen, nicht aber auf der von Institutionen, Parteien und Kandidaten gebildeten Angebotsseite.
Olaf Jann rückt die laufende Populismusdebatte in den Kontext kultureller Hegemoniekämpfe, bei denen – nicht ohne Züge von Bigotterie – Populismus als „dunkle Seite der Demokratie“ (176) gekennzeichnet wird. Dagegen vertritt er – wie ähnlich auch Claudia Koppetsch (2018) oder Andreas Reckwitz (2019) – die These, dass durch die „gegenwärtige Populismusdebatte lediglich ein sozialstruktureller Konflikt verdeckt wird, welcher wiederum anhand einer kulturellen Demarkationslinie nachgezeichnet werden kann“ (178).
Im dritten Themenblock setzen sich (leider nur) zwei Beiträge konkret am Gegenstand mit neuen Partizipationsformen auseinander. Gary S. Schaal und Fränze Wilhelm diskutieren die Anwendungsbedingungen von deliberativen Minipublics, also relativ offenen Beteiligungsformaten auf lokaler Ebene, die, im Auftrag von Verwaltungen und eingebettet in den Kontext liberal-repräsentativer Institutionen, Phänomenen sinkenden politischen Vertrauens und nachlassender Partizipation entgegenwirken sollen. Wenn derartige Verfahren eine höhere Berücksichtigung der Interessen eher artikulationsschwacher Gruppen erreichen wollen, dann – so lautet ihr Vorschlag – sollten die Minipublics stärker an Kriterien der Beteiligungsgerechtigkeit als an denen formaler Gleichheit ausgerichtet sein.
Dem würden Verfahren der Gruppenrepräsentation auf Basis von Zufallsauswahl und (Milieu-)Quotierung entsprechen. Am Beispiel der jüngsten Reformen des parlamentarischen Petitionswesens in Deutschland – mit der das Instrument der Onlinepetition eingeführt worden ist – vergleicht Markus Linden in demokratietheoretischer Perspektive Funktionen und Effekte staatlicher und privater Plattformen. Sein Votum fällt eindeutig aus: Statt den privaten Plattformen, die teils an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtet sind, teils als Kampagnenorganisationen auf einseitige Fokussierung von Themen setzen, über Public Private Partnerships noch größeren Einfluss in Kernbereichen demokratischer Verfahren einzuräumen, sollte das parlamentarische Petitionswesen weiter aufgewertet und offener ausgestaltet werden. Warum diesem Themenblock die Verschriftlichung einer Podiumsdiskussion zwischen Ingolfur Blühdorn, Robin Celikates, Hans Lietzmann und Christian Volk zugeordnet ist, erschließt sich nicht recht, geht es in ihr doch überwiegend um eine letztlich kontrovers bleibende Bestimmung des ‚populistischen Moments’.
Die Autor*innen der drei Beiträge des vierten und letzten Themenblocks diskutieren die Frage, was Demokratie jenseits nationalstaatlicher Verfasstheit bedeuten könnte. Im Anschluss an ihre Studie über Flüchtlinge als Grenzfiguren (2017) entwickelt Julia Schulze-Wessel eine Perspektive jenseits eines methodologischen Nationalismus, in der Geflüchtete als politische Subjekte durch ihre Akte von Grenzverletzungen zugleich die Legitimität herkömmlicher territorialer Grenzziehungen infrage stellen. In ihrer ambivalenten Rolle, die sie vom Privileg der Staatsbürgerschaft ausschließt, machen sie faktische Transformationen als räumliche Verschiebungen von Demokratien sichtbar.
Eine andere Dimension derartiger Transformationen greift Anna Meine auf. „Wenn soziale, territoriale und politische Räume nicht länger kongruent sind und Governance vielfältige Formen annimmt“ (293), dann stellt das die Demokratietheorie vor die Frage nach den Konditionen einer Pluralisierung demokratischer Mitgliedschaften. In Auseinandersetzung mit Positionen von Jürgen Habermas, James F. Bohmann und Seyla Benhabib entwirft Meine das Modell komplementärer demokratischer Mitgliedschaften, die jeweils einem begrenzten demos entsprechen, getrennten (räumlichen oder thematischen) Kontexten zugeordnet werden und einen Beitrag zur Gesamtordnung leisten.
Eine komplementäre Problemstellung untersucht Markus Patberg in inspirierender Weise am Beispiel der EU-Verfassungspolitik. Der Verlauf der Eurokrise hat nicht nur die Asymmetrien zwischen Gläubiger- und Schuldnerstaaten innerhalb der Eurozone vertieft, sondern zugleich auch die legitimatorischen Defizite des demokratischen Intergouvernementalismus stärker zutage treten lassen, insofern dieser faktisch „die Exekutive an die Spitze eines Prozesses der Rechtssetzung“ (312) stellt. Im Kontrast zu vielfach geforderten direktdemokratischen Verfahren sieht Patberg Möglichkeiten einer Überwindung der Defizite des Intergouvernementalismus in der Institutionalisierung permanenter Verfassungsversammlungen, in denen einerseits mitgliedstaatliche und andererseits gesamteuropäische Interessen repräsentiert werden. Die entsprechenden Gremien wären eine aus europaweiten Wahlen hervorgehende Kammer der EU-Bürgerinnen und eine Kammer der Staatsbürgerinnen, die sich aus Delegierten der jeweiligen nationalen Verfassungsversammlungen zusammensetzt. Die Etablierung eines in diesem Sinne doppelten Verfassungsgebers wäre dann die institutionelle Antwort auf den Umstand, dass sich das „Gemeinwohl eines supranationalen Gemeinwesens […] weder auf die Interessenlagen der mitgliedstaatlichen Bevölkerungen noch auf die der übergreifenden Bürgergemeinschaft reduzieren“ lässt (319).
Fazit
Insgesamt bieten die Beiträge durchaus anregende Annäherungen an die Frage, in welcher Hinsicht heute von einem Formwandel von Demokratie gesprochen werden könnte. Die weitgehend eingehaltene Distanz gegenüber gängigen Krisennarrativen öffnet dabei den Blick für unterschiedliche Zugänge. Mit dem gewählten Fokus auf die Form von Demokratie wird jedoch zugleich eine Perspektive eingenommen, die sich auf Institutionen konzentriert und andere – gesellschaftsstrukturelle – Lesarten eher ausblendet (vgl. dagegen Ketterer/Becker 2019).
Bezogen auf die Leitfrage überzeugen vor allem die Untersuchungen neuer Partizipationsformen (Themenblock 3), weil sie anschaulich zeigen, mit welchen Restriktionen und Widersprüchen die konkrete Implementierung innovativer Verfahren rechnen muss. Ebenso überzeugen die Reflexionen über Demokratie in postnationalen Konstellationen (Themenblock 4), weil sie herausarbeiten, dass die Übertragung demokratischer Prinzipien auf transnationale Kontexte zahlreiche normative Fragen neu stellt.
Literatur
Ketterer, Hanna / Karina Becker (Hrsg). (2019): Was stimmt nicht mit der Demokratie? Eine Debatte mit Klaus Dörre, Nancy Fraser, Stephan Lessenich und Hartmut Rosa. Berlin Suhrkamp Verlag.
Koppetsch, Cornelia (2018): Soziologiekolumne. Eine Welle der Nostalgie. Die akademische Mittelschicht und die illiberale Gesellschaft. In: Merkur 72. Jg., Heft 838, September, S. 53-58.
Andreas Reckwitz (2019): Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Berlin Suhrkamp Verlag.
Schulze Wessel, Julia (2017): Grenzfiguren – Zur politischen Theorie des Flüchtlings, Bielefeld: transcript Verlag.
Thaa, Winfried / Christian Volk (Hrsg.) (2018): Formwandel der Demokratie. Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.