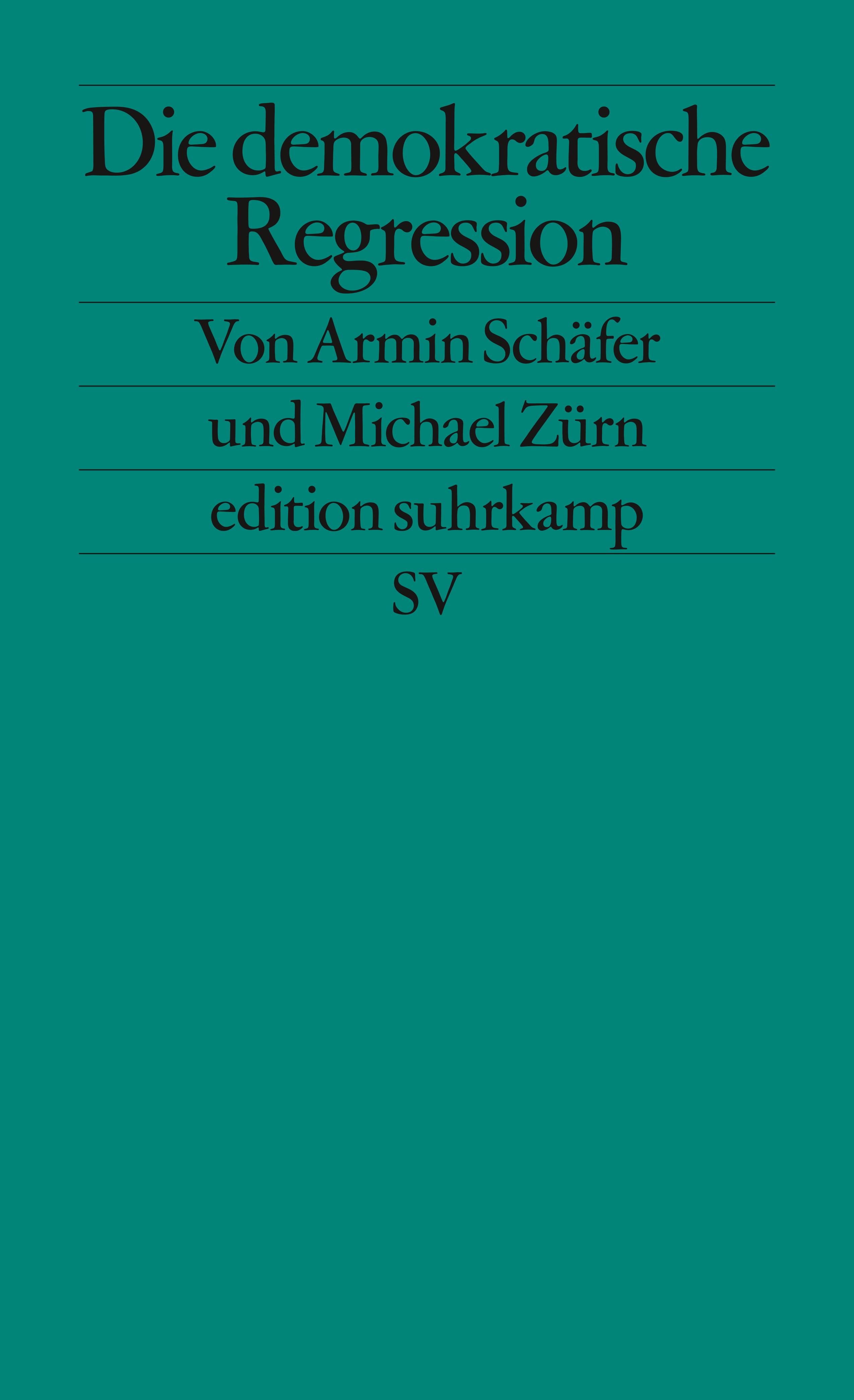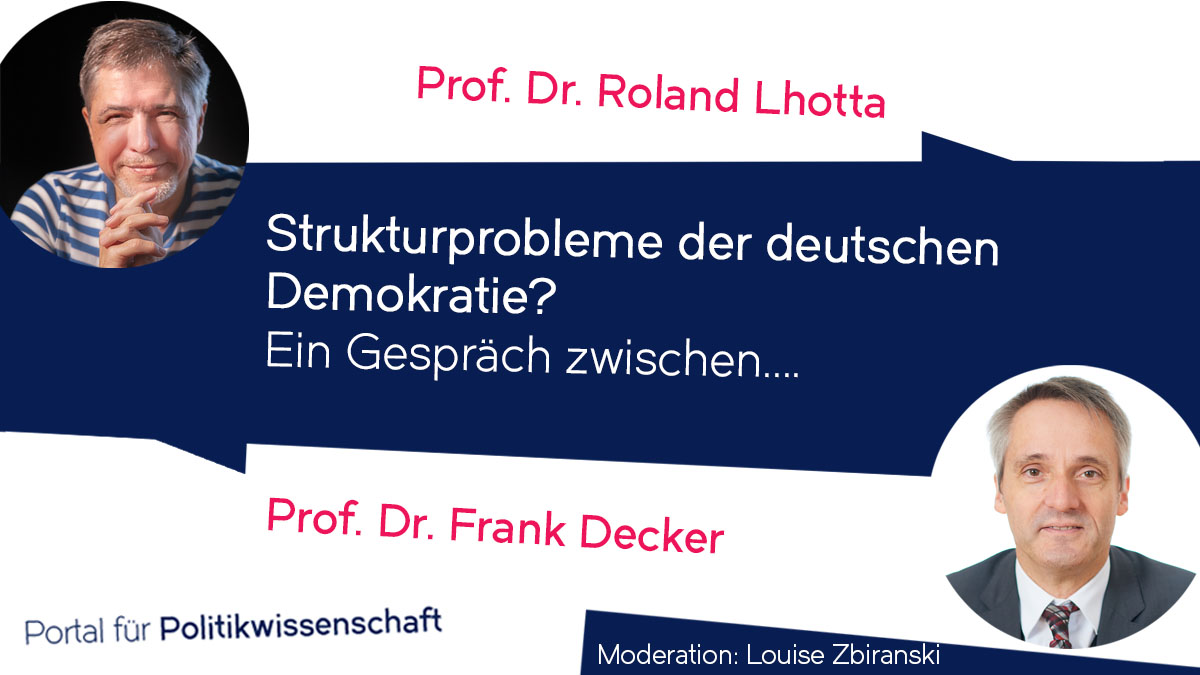Armin Schäfer / Michael Zürn: Die demokratische Regression
09.09.2022Was macht den autoritären Populismus für Bürger*innen so attraktiv? Armin Schäfer und Michael Zürn erklären dies mit tatsächlichen Problemen liberaler Demokratien: Populist*innen dienten als Lackmustest, da sie wunde Punkte von (Un-)Gleichheit und (fehlender) parlamentarischer Repräsentation adressierten, so auch unsere Rezensentin Tamara Ehs. Diskutiert werde dabei die Gefährdung der, an sich als gefestigt geltenden, Demokratien in Europa vor dem Hintergrund jüngster Krisen – analytisch wird all dies in Datensätze und Ergebnisse verschiedener Demokratieindizes eingebettet. (tt)
Eine Rezension von Tamara Ehs
Warum fahren Parteien wie AfD, FPÖ oder Rassemblement National Wahlerfolge ein? Warum kommen Politiker wie Donald Trump an die Macht? Sind ihre Wähler*innen „alle Nazis“, oder schlicht zu dumm und lassen sich von ein paar Scharlatanen in die Irre führen? Armin Schäfer und Michael Zürn stimmen in gängige Entlastungserklärungen für die politische Elite nicht ein; sie suchen den Grund nicht in der Unzulänglichkeit der Bürger*innen. Im Gegenteil erklären sie den Aufstieg der Autoritären aus der Politik selbst. Ihnen zufolge „verfängt der autoritäre Populismus auch deshalb, weil seine Kritik an der Funktionsweise der liberalen Demokratie einen wahren Kern hat“ (196). Die Autoren entwickeln eine zutiefst politische Theorie des autoritären Populismus, ausgehend von der These, „dass erst der politisch selektive Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen eine populistische Abwehrreaktion provoziert. Eine genuin politische Erklärung des Populismus setzt an realen Repräsentationsdefiziten an“ (17). Zeitgenössische Populist*innen legten demnach den Finger in die Wunde der liberalen Demokratie – ohne allerdings die grundlegenden Probleme zu lösen. Letztlich sind ihre Wähler*innen noch enttäuschter als zuvor und wenden sich letztlich ganz von der Politik ab. Es komme, so Schäfer und Zürn, zu einer „doppelten Entfremdung“ (10): Die Demokratie entferne sich einerseits zusehends vom Ideal der Repräsentation, die Bürger*innen zögen andererseits nach und nähmen an den Aushandlungsprozessen jener Institutionen, die sie nur mehr selektiv vertreten, nicht mehr teil.
Für die Entwicklung ihres Arguments greifen die beiden Autoren auf umfangreiche Datensätze zurück, die sie teils in eigener jahrelanger Forschung erstellt haben, teils führen sie Daten aus internationalen Demokratieindizes in neuer Interpretation zusammen. Ausgehend von der durch den Ökonomen Branko Milanović bekannt gewordenen „Elefantenkurve der Einkommenszuwächse“ diskutieren sie, inwiefern die wachsende sozioökonomische Ungleichheit ein Problem für die Demokratie darstellt. Im Fokus stehen dabei die konsolidierten Demokratien Europas und ihre Reaktionen auf die Krisen der vergangenen Jahre, insbesondere die Finanz- und Eurokrise, zuletzt die Coronakrise. Die gegenwärtige Energie(kosten)krise reiht sich aufgrund ihrer Auswirkungen auf den Wohlstand der Gesellschaft mitsamt der damit, bis weit hinein in den Mittelstand, verbundenen Abstiegsängste in die Erläuterungen von Schäfer und Zürn ein, obgleich sie diese natürlich noch nicht in ihre Analyse haben aufnehmen können. Für die Leser*innen wird allerdings so manches Argument der beiden angesichts täglich steigender Preise und einer weithin perzipierten fehlenden Handlungsdringlichkeit seitens der Politik umso nachvollziehbarer. Denn die Autoren legen aufschlussreich dar, wie die materielle Basis für die Unterstützung der Demokratie aufweiche und wir uns deshalb bereits in einer dritten Welle der Autokratisierung befänden. Hatte Samuel Huntington 1993 noch die „dritte Welle der Demokratisierung“ gefeiert, sei jener Fortschrittsglaube mittlerweile eines Besseren belehrt worden.
Da die Rahmenbedingungen, wie wir sie aus den Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegsordnung kennen, seit mittlerweile vier Jahrzehnten erodieren, erleide die Demokratie einen merklichen Verlust ihrer Strahlkraft, zumal auch autoritär regierte Staaten wie China „eine erkennbare Gemeinwohlkomponente [haben] und dabei auf erhebliche Fortschritte insbesondere bei der Armutsbekämpfung verweisen“ (9). Neben den realen Wohlstandsverlusten und den gebrochenen Aufstiegsversprechen für die nachfolgende Generation, die oftmals prekärer als ihre formal weniger gebildeten Eltern lebt, sei es die unzulängliche Erfüllung zweier Grundprinzipien, die die demokratische Regression beschleunige. Die Demokratie benötigt laut Schäfer und Zürn die Wahrnehmung des Betroffenheits- und des Deliberationsprinzips (27): Alle von einer Entscheidung Betroffenen sollten ein Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung haben; und sämtliche Entscheidungen müssten öffentlich erörtert und durch Argumente gerechtfertigt werden. Doch die Daten verweisen auf eine gesunkene Repräsentativität und Responsivität. Laut Pew Research Center (90) bejahen in Deutschland nur 33 Prozent die Frage „Glauben Sie, dass die gewählten Offiziellen in Ihrem Lande sich dafür interessieren, was Leute wie Sie denken?“ In Frankreich sind es gar nur mehr 23 Prozent.
Armin Schäfer und Michael Zürn ergründen dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, und machen zwei Hauptprobleme aus: Die Parlamente seien zum einen nicht mehr responsiv und zum anderen überhaupt nicht mehr zuständig. Die Kerninstitution der repräsentativen Demokratie repräsentiert also nicht mehr alle Betroffenen und ist in der Deliberation vieler Entscheidungen gar nicht souverän. Die mangelnde Responsivität führen die Autoren auf eine politische Klasse zurück, die weniger denn je die Bevölkerung (also die Betroffenen) abbilde. Sie sprechen deshalb von einer „Diplomiertendemokratie“ (96), deren Vertreter*innen den Alltag der von ihnen Vertretenen kaum mehr aus eigenem Erleben kenne. Daraus folgt, dass sich die ungleichgewichtige Repräsentation in die parlamentarische Arbeit übersetze: „Die numerische Unterrepräsentation bestimmter Gruppen führt zu einer Unterrepräsentation bestimmter politischer Meinungen“ (97). Wie Lea Elsässer in ihrem Buch Wessen Stimme zählt? (2018) eindrücklich darlegte, fallen auch in Deutschland politische Entscheidungen überproportional zugunsten der ressourcenstarken Gruppen aus.
Zu jenem, bereits allein für die Funktionsweise der Demokratie gravierenden, Problem kommen der Souveränitätsverlust und die relative Entmachtung der Parlamente hinzu. Nichtmajoritäre Institutionen wie Verfassungsgerichte, Zentralbanken und internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) oder der Internationale Währungsfond (IWF) hätten immens an Entscheidungskompetenz gewonnen. Sie brächten zwar „Expertise und Sachkenntnis in die Politik [, ...] sind aber gewiss nicht politisch neutral“ (114). Ihre Gefahr für die Demokratie bestehe in der „Entpolitisierung bis dato politischer Fragen“ (115). An ihnen setze folglich auch die Kritik der Populist*innen an, wenn sie für eine „echte Demokratie“ Volksentscheide und Plebiszite verlangten, gegen die Urteile des Bundesverfassungsgerichts wetterten und sich „gegen Brüssel“ wendeten. Die „mehrheitsfixierte Komponente des autoritären Populismus“ (66) habe demnach ebenso einen wahren Kern, wie das Gefühl vieler Menschen, nicht mehr gehört zu werden.
Schäfer und Zürn fassen zusammen: „Die selektive Responsivität der Parlamente sowie die Verlagerung von Entscheidungen auf nichtmajoritäre, nur indirekt legitimierte Gremien stellen in unserer Terminologie eine Entfremdung der politischen Entscheidungsprozesse vom Ideal der Demokratie dar. Sie führe, so die andere Seite der Medaille, zu einer Entfremdung von der Demokratie bei jenen Gruppen, die sich nicht länger politisch vertreten fühlen. Als Konsequenz der doppelten Entfremdung könne der Aufstieg autoritär-populistischer Parteien beobachtet werden“ (120 f.). Die Daten der Studie European Social Survey belegen dies: Je eher Menschen der Ansicht sind, sie würden nicht gehört und hätten ohnehin keinen Einfluss auf Entscheidungen, desto höher ist der Stimmenanteil für autoritär-populistische Parteien. Das Gefühl des Nicht-gehört-Werdens hat dabei eine klar sozioökonomische Komponente, die wiederum auf die Schieflage in der parlamentarischen Repräsentation repliziert (126).
Was also tun, zumal in Zeiten multipler Dauerkrise? Die Autoren belegen mit Daten von V-Dem klar, dass Populist*innen an der Macht die Demokratie bloß noch weiter schwächten. Selbst in der Opposition richten sie Schaden an, weil sie das politische Koordinatensystem allmählich immer weiter nach autoritär-rechts verschieben, wie wir etwa aus jahrelanger Anschauung Österreichs wissen. So machen Schäfer und Zürn schließlich Empfehlungen und formulieren Reformvorschläge, die ohnehin seit Jahren bekannt sind. Da diese aber noch immer auf Umsetzung warteten, müssten sie abermals vorgebracht werden: Es gelte, neben der autokratischen „auch der technokratischen Versuchung zu widerstehen“ (204), Bürgerversammlungen einzusetzen, Ungleichheit abzubauen, das Rekrutierungsmuster der Parteien zu ändern, mehr Kontrolle über nichtmajoritäre Institutionen auszuüben etc.
Somit liegt ein leicht zu lesendes Buch vor, das auf eindrückliche Weise und breiter Datenbasis die Gründe für die Autokratisierungstendenzen in, eigentlich für konsolidiert zu haltenden, Demokratien darlegt. Die Wissenschaft ist sich der Zusammenhänge mittlerweile weitgehend klar. Was fehlt, ist die Wahrnehmung des politischen Gestaltungsauftrags. Politiker*innen von nicht-autoritärpopulistischer Prägung, welche dieser Tage noch knapp Wahlen gewinnen (Joe Biden, Emmanuel Macron und andere), sollten nicht froh sein, dass es „noch mal gut gegangen ist“, sondern dringend an der Demokratisierung der Demokratie arbeiten.