Kleingedrucktes zum Pariser Abkommen verabschiedet. Eine erste Bewertung der COP24 in Katowice
... um Klimawandel ein. Dieser Gipfel und der unter der Ägide der Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) stattfindende fortlaufende Prozess werden hoffentlich d ......Internationale Klimapolitik 2018. Von Paris über Bonn nach Katowice
... / Creative Commons Attribution 2.0 Generic license). Etwas über zwei Jahre nachdem sich die Weltgemeinschaft – in Gestalt der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) ......Von Hamburg nach Buenos Aires. Wird der diplomatische Erfolg der G20 fortgesetzt?
... der Vereinten Nationen (UNFCCC) innewohnende Abstimmungsproblem zu beheben. Während die Staats- und Regierungschefs in ihrer Erklärung versprechen, „zügig auf eine vollständige Umsetzung [des Pariser ......Diplomatische Pflicht ohne politische Kür. Eine erste Bewertung der Klimakonferenz COP23 in Bonn
... Vertragsparteien (Conference of the Parties, kurz COP23) zur Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) statt. Zentrale Themen der Konferenz waren die Entwicklung ......Klimapolitik trotz(t) Trump. Globaler Klimaschutz nach dem Rückzug der USA
... – Ecological Perspectives for Science and Society, 25(1), 19–22. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:wup4-opus-62761 • Hermwille, L., Obergassel, W., Ott, H., Beuermann, C. (2017). UNFCCC before and ......Das Pariser Klimaschutzabkommen in der Analyse. Kommentierte Auswahl politikwissenschaftlicher Beiträge und Bücher
... im politischen Kontext der Verhandlungen aufzuzeigen. Die indische Politikwissenschaftlerin war während des Pariser Gipfels für das UNFCCC-Sekretariat tätig. Lavanya Rajamani (2016): Ambition And Differentiatio ......Das Pariser Klimaschutzabkommen – analysiert und bewertet von deutschen und internationalen Denkfabriken
... ich bei der UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) ein deutlicher Wandel durchgesetzt. Sei es früher das Ziel gewesen, nur „dangerous climate change“ zu vermeiden, werde nun „any gl ......John Vogler: Climate Change in World Politics
... werden? Entgegen der Festschreibungen in der „United Nations Framework Convention on Climate Change“ (UNFCCC) seien aus der Perspektive der Klimaforscher, aber auch des „‚common sense‘“ (13) die staatlichen ......Climate Change: International Law and Global Governance
... mit der beide Gruppen von Staaten der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) nachkommen können. ......On Strategies for Avoiding Dangerous Climate Change: Elements of a Global Carbon Market
... und aktuelle Analyse der gegenwärtigen Klimapolitik, die neben der United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) auch ganz grundsätzlich Fragen der Nützlichkeit klimapolitischer Instrumentarien ......UNFCCC
UNFCCC...Das Pariser Klimaschutzabkommen in der Analyse. Kommentierte Auswahl politikwissenschaftlicher Beiträge und Bücher
... im politischen Kontext der Verhandlungen aufzuzeigen. Die indische Politikwissenschaftlerin war während des Pariser Gipfels für das UNFCCC-Sekretariat tätig. Lavanya Rajamani (2016): Ambition And Differentiatio ......Der Klimaschutz – die große globale Aufgabe. Das Pariser Klimaschutzabkommen im Spiegel von Wissenschaft und Politikberatung
Ist das Pariser Klimaschutzabkommen der von vielen Menschen erhoffte historische Meilenstein auf dem Weg hin zu einer aktiven Klimaschutzpolitik? In den Beiträgen zu diesem Thema wird sich dieser Frage aus verschiedenen Perspektiven genähert. Wir stellen die Diskussionen über den Klimawandel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sowie seine Versicherheitlichung vor und verweisen auf die wissenschaftliche Arbeit verschiedener Institute. Mit Blick auf die Paris folgenden UN-Weltklimakonferenzen wird die weitere Entwicklung, auch angesichts der Haltung der Trump-Administration, aufgezeigt.
Die Versicherheitlichung des Klimawandels. Über die ambivalenten Folgen einer Diskursverschiebung

Führt die Erderwärmung nicht nur zu ökologischen Krisen, sondern auch zu sozialen Konflikten? Destabilisiert der Klimawandel politische Systeme? Verändert er globale Machtverhältnisse? Erhöht er die Wahrscheinlichkeit bewaffneter Auseinandersetzungen? Verstärkt er Migrationsströme? Der menschengemachte Klimawandel wurde lange überwiegend als umwelt- und entwicklungspolitisches Thema diskutiert, zunehmend werden in Debatten aber auch verstärkt seine sicherheits- und geopolitischen Aspekte betont. Die beiden Bücher „Climate Terror“ und „The Securitisation of Climate Change“ sind den Hintergründen und Folgen dieser Diskursverschiebung gewidmet.
John Vogler: Climate Change in World Politics
... werden? Entgegen der Festschreibungen in der „United Nations Framework Convention on Climate Change“ (UNFCCC) seien aus der Perspektive der Klimaforscher, aber auch des „‚common sense‘“ (13) die staatlichen ......Wer forscht? Deutsche Projekte zur Klimapolitik. ine Übersicht der im Jahr 2016 laufenden Vorhaben
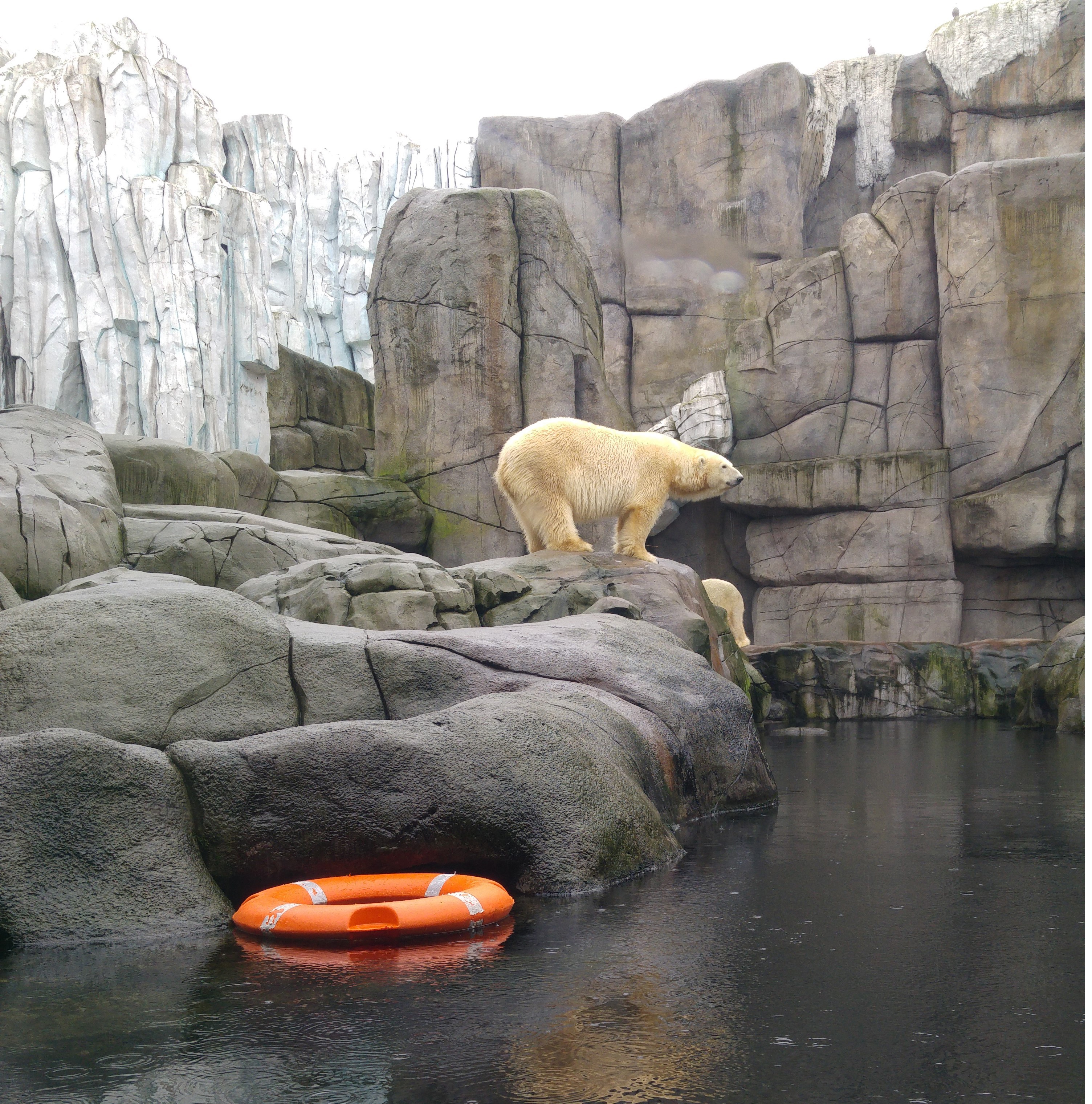
Angesichts des Klimawandels als globaler, hochkomplexer Herausforderung besteht in Politik und Öffentlichkeit eine wachsende Nachfrage nach Beratung und wissenschaftlich fundierten Grundlagen für politische Entscheidungen. Dies kann als besondere Begründung für eine breite öffentliche Forschungsförderung in diesem Bereich gesehen werden. Daher soll die folgende, nicht abschließende Übersicht über die im Jahr 2016 laufenden deutschen Forschungsprojekte im Bereich Klimapolitik mit einer Auflistung der Projekte beginnen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert werden.