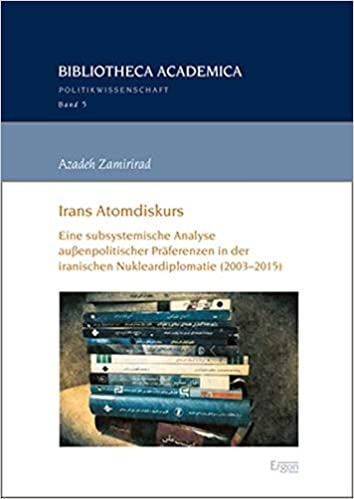Azadeh Zamirirad: Irans Atomdiskurs. Eine subsystemische Analyse außenpolitischer Präferenzen in der iranischen Nukleardiplomatie (2003-2015)
20.04.2020Im Jahre 2002 wurde bekannt, dass der Iran zwei Nuklearanlagen der Internationalen Atomenergiebehörde nicht gemeldet hatte. Diese Tatsache führte zu einer neuen außenpolitischen Herausforderung für den Iran, bis schließlich am 14. Juli 2015 ein Atomabkommen zustande kam, das die „zivile Ausrichtung des iranischen Atomprogramms mittels eines ‚Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans‘ (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) gewährleisten sollte.“ (13)
Azadeh Zamirirad legt den Fokus ihrer Untersuchung nicht auf die Positionen, die politische Akteure in Verhandlungssituationen einnehmen, sondern auf „ihre[.] nuklearpolitischen Präferenzen, die den Verhandlungspositionen vorausgehen“ (15). Eine systematische Analyse inneriranischer Einflussfaktoren in der Nuklearpolitik sei bislang nicht vorhanden. Diese Lücke will die Autorin mittels eines komplementären Ansatzes schließen, indem sie die Präferenzen subsystemischer Akteure rekonstruiert. Akteurszentrierte Theorieansätze werden mit diskursanalytischen Methoden verbunden – der Untersuchungszeitraum erstreckt sich auf die Verhandlungsjahre zwischen 2003 und 2015.
In der Arbeit werden die Präferenzen der iranischen Nukleardiplomatie offengelegt. Diese haben sich Zamirirad zufolge in den Verhandlungspositionen niedergeschlagen und den diplomatischen Durchbruch bei den Atomverhandlungen erzielt. Die Verfasserin beleuchtet die Argumentationen der politischen Eliten im Nukleardiskurs und hebt hervor, dass mit diesem Ansatz nur ein Teilaspekt abgebildet werden könne, „wodurch die Analyse notgedrungen unvollständig bleiben muss“ (15).
Zamirirad setzt für ihre Untersuchung den liberalen Denkansatz von Ira Katznelson und Barry R. Weingast ein, wonach Präferenzen „Inklinationen“ (41) darstellen, die Akteure aufweisen. Die Fokussierung auf gesellschaftliche Akteure sei nicht zielführend, da „der iranische Staat eine größere Autonomie gegenüber gesellschaftlichen Forderungen aufweist als offene politische Systeme“ (42). Um die Rolle des Revolutionsführers Ali Khamenei besser analysieren zu können, erweitert sie ihren Ansatz durch das Konzept des „Vetospielers“, das Andrew Moravcsik entwickelt hat. Zwar könne Khamenei mit seiner Stimme Entscheidungen blockieren, zugleich würden „andere Akteure im Prozess der Entscheidungsfindung auf ihn“ (42) einwirken.
In Anlehnung an Johannes Reissner geht die Autorin davon aus, dass die Macht in der Islamischen Republik Iran tendenziell aufgesplittert ist und ein „informelles Verfahren“ (73) von checks and balances verschiedener Faktionen verhindert, dass die Herrschaftsbasis des Revolutionsführers gefährdet wird. Gleichzeitig steuere der Revolutionsführer durch seine Personalpolitik die Machtverteilung der Faktionen, wenn diese aus dem Gleichgewicht gerät.
Vor allem der Zerfall der Sowjetunion und die Golfkriege haben Zamirirad zufolge bewirkt, dass es „einen Paradigmenwechsel von einer ideologisch getriebenen zu einer vornehmlich pragmatischen Erwägungen folgenden Außenpolitik“ (78) gab. Religiöse Imperative seien in den 1990er-Jahren in den Hintergrund geraten, stattdessen bestimmte das nationale Interesse die iranische Außenpolitik. Bereits Präsident Mohammad Khatami habe Bereitschaft zum Dialog mit den westlichen Staaten gezeigt. Das Feindbild der USA und die Nichtanerkennung des israelischen Staates seien geblieben. In Anlehnung an Walter Posch habe sich in außenpolitischen Entscheidungsverfahren ein „Dreiebenenprozess“ (87) herausgebildet. Es gebe ein Zusammenwirken von formellen Institutionen mit informellen Gremien, die zu Entscheidungen führen. Die letzte Entscheidung treffe jedoch der Revolutionsführer Ali Khamenei. Laut Präsident Rohani sei eine Entscheidung des Obersten Rechtsgelehrten „nie“ (88) von politischen Flügeln blockiert worden.
Mit der Textanalyse der Argumente und Konklusionen von iranischen Atomdebatten macht die Autorin deutlich, dass die Topoi im iranischen Nukleardiskurs neben „Selbst- und Fremdwahrnehmungen sowie Einschätzungen nuklearpolitischer Sachverhalte vor allem Handlungsempfehlungen abbilden.“ (93) Zentral sind die Positionen von Ali Khamenei. Der Revolutionsführer greife bei fortschreitender öffentlicher Diskussion in die Nukleardebatte ein. „[D]en Vorwurf eines militärischen Atomprogramms 2003“ (137) habe er zurückgewiesen.
Atomwaffen stellen nach Khamenei „keine Garantie für Staatserhalt“ (138) dar. „Fortschritt auf dem Gebiet der Kernkraft, so die Beherrschung des vollständigen Brennstoffkreislaufs“ (139), sei laut Khamenei die Voraussetzung für die Unabhängigkeit und Autarkie des Landes. Zudem trage die wissenschaftliche und technologische Beherrschung von Atomkraft zur „nationalen Ehre“ (139) bei. Zamirirad schreibt weiterhin: „Das iranische Atomprogramm ist nach Khamenei demnach nicht Ursache der international ‚erzeugten‘ Krise, sondern lediglich Symptom für die fundamentale Ablehnung einer islamischen Ordnung iranischer Lesart.“ (141) Daher sei die Atomfrage nur ein Vorwand, um Resolutionen und Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. Folglich werde ein Einlenken bei den Verhandlungen zur Atompolitik das Anliegen des regime change nicht ausräumen, fasst Zamiriad das Denken von Ali Khamenei zusammen. 2013 sei die Nukleardebatte um die Parole der „heroischen Flexibilität“ (143) erweitert worden. Ein Einlenken sollte ohne Gesichtsverlust nach religiösen Vorbildern ermöglicht werden. Khamenei habe der Regierung infolgedessen neue außenpolitische Handlungsspielräume eingeräumt. Er definierte rote Linien, die beispielsweise vorschrieben, dass die Beziehungen zu den USA, die innenpolitische Lage im Iran oder politische Fragen, die die regionale Strategie des Iran betrafen, nicht zum Gegenstand von Nuklearverhandlungen gemacht werden sollten. Zudem habe Khamenei gefordert, dass „sämtliche Sanktionen bei Abschluss einer Übereinkunft sofort aufgehoben werden müssen“ (144).
Schließlich habe Khamenei einer Einigung im Nuklearkonflikt zugestimmt. Am 14. Juli 2015 sei ein Durchbruch erzielt und der Gemeinsame Umfassende Aktionsplan (JCPOA), der das zivile iranische Atomprogramm gewährleisten sollte, vereinbart worden. Daraufhin wurde am 20. Juli die UN-Sicherheitsresolution 2231 verabschiedet.
Am 16. Januar 2016 habe die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) verkündet, dass „Iran seiner Verpflichtung zur Implementierung“ (173) nachgekommen sei. Demnach konnten die Sanktionen der USA und der EU zunächst suspendiert werden.
In ihrer Konklusion hebt die Autorin hervor, dass die iranische Nukleardiplomatie zwischen 2003 und 2015 mehrere Positionsänderungen vollzogen habe. Iranische Multilateralisten und Unilateralisten seien sich zumeist einig, dass „Iran das Recht zur eigenen Anreicherung von Uran“ (175) zustehe. Zamiriad kommt zu dem Ergebnis, dass der Revolutionsführer zwar über eine maßgebliche, aber nicht ausschließliche Entscheidungsgewalt verfüge. Die iranische Atompolitik sei das Ergebnis eines „formellen wie informellen intraelitären Aushandlungsprozesses, an dem Akteure innerhalb und außerhalb der Regierungsverantwortung beteiligt waren“ (180). In diesem Buch, das die 2015 fertiggestellte Dissertation darstellt, werden die konformistischen Standpunkte verschiedener Akteure analysiert, politische Aspekte jedoch, die die Diplomatie einer islamistischen Diktatur prägen und als Störfaktoren die internationale Diplomatie blockieren, werden ausgeblendet und nicht diskutiert.