Nina Horaczek / Barbara Tóth: Sebastian Kurz. Österreichs neues Wunderkind?
21.06.2018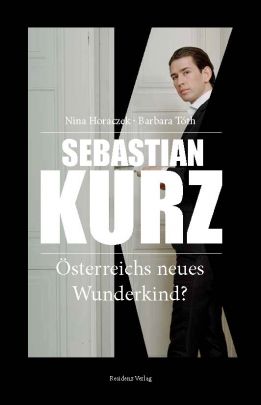
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist jung an Lebensjahren und Lebenserfahrung, entsprechend schmal muss eine Biografie des 31-Jährigen wohl ausfallen. So würden zumindest seine Kritiker, und derer hat er nicht wenig, spotten. In der Tat gerade einmal 126 Seiten füllen die beiden Falter-Journalistinnen Nina Horaczek und Barbara Tóth dann auch. Ein Gespräch mit Kurz, der seine Medienkontakte sehr bewusst steuert, haben die beiden nicht führen können. So haben sie aus Sekundärquellen und Gesprächen mit Weggefährten seinen Weg an die Spitze der Alpenrepublik rekonstruiert. Wirklich spannend ist der Lebensweg von Kurz dabei keineswegs, aber dennoch ist er wohl interessant. Bei Kurz handelt es sich nämlich um ein „typisches Produkt seiner Generation“, die „nicht auf Revolution, sondern auf Aufstieg durch Anpassung“ (83) setzt.
Man erkennt in Kurz tatsächlich vieles, was seine Generation ausmacht oder ausmachen soll. Der Neoliberalismus hat in den Nullerjahren sicherlich eine prägende Funktion für die politische Sozialisation gespielt. Der Lebenslauf ist frei von existentiellen Erfahrungen. Schule, Matura und Studium fließen in Förderprogramme ein. Das politische Engagement steht am Ende einem erfolgreichen Studienabschluss entgegen. Für den Fall, dass es mit der Politlaufbahn nicht geklappt hätte, waren indes die Netzwerke schon aktiviert. Im Leben Sebastian Kurz‘ steht er selbst im Zentrum.
Ob es wirklich ein Generationenphänomen ist, mag dahingestellt bleiben. Kurz ist jedenfalls vom Leistungsversprechen angetan, kann dem österreichischen System der institutionalisierten Sozialpartnerschaft daher nicht viel abgewinnen, gleichwohl hätte er ohne dieses System kaum innerparteilich reüssieren können. Sein Netzwerk, das er in der JVP spannen kann, ist gerade deswegen so wirksam, weil nur die Jugendorganisation der ÖVP wirklich quer zur Struktur der Bünde organisiert ist. Das macht sich Kurz zunutze. Hierüber sichert er sich früh Gefolgschaft, baut sich eine ihm loyal ergebene Truppe auf. Ihm hilft dabei paradoxerweise sogar, dass er aus der SPÖ-Hochburg Wien stammt. Die notorische Erfolglosigkeit der Volkspartei in der Hauptstadt nutzt ihm, weil sich ihm dadurch Profilierungsmöglichkeiten bieten, die ihm in anderen Bundesländern nicht bereit stünden. Dort hätten ihn Patronage und geordnete Karrieremöglichkeiten eingehegt. In Wien hingegen kann Kurz Peinlichkeiten produzieren, wie man sie zu Zeiten der Westerwelle-FDP Anfang der 1990er-Jahre auch in Deutschland erleben konnte. Zugleich ist Kurz schlau genug, sich nicht in der Wiener ÖVP zu verheizen. Zwei Mal lehnt er die Führung der dortigen Partei ab. Sein Ziel ist der Ballhausplatz, wo das Kanzleramt steht.
Für Kurz gilt, dass jede Nachricht über ihn seine Bekanntheit fördert. Inhaltlich legt er sich wenig fest, vermeidet kategorische Aussagen zu Positionen. Als Integrationsstaatssekretär und Außenminister kann er mit einigem Geschick freilich bei schwierigen Themen tatsächlich Profil gewinnen. Doch Kurz, auch hier ganz Kind seiner Generation, hat eben keine Grundsatzpositionen, die unumstößlich sind. Im Kern ist er aus der Sicht seiner Biografinnen „Effektpolitiker“ (80). Entscheidend ist, ob die jeweilige Aussage zum Zeitgeist passt und ob sie hinreichend Offenheit für einen anderen Zeitgeist in späteren Zeiten lässt.
Diese Biografie zeigt etwas auf, was vielleicht einmalig ist: Es wird der strategische Karriereplan eines Berufspolitikers ausgebreitet, den dieser in taktischer Hinsicht geradezu minuziös durchzieht. Politik wird oft als Abfolge von Gelegenheiten dargestellt, in denen es darauf ankommt, die passende Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Kurz hingegen wartet darauf nicht, sondern arbeitet darauf hin, an die Spitze zu treten. Und so bleibt der heutige Bundeskanzler ein Phänomen, das sich vielleicht in einigen Jahren besser ausdeuten lässt.
