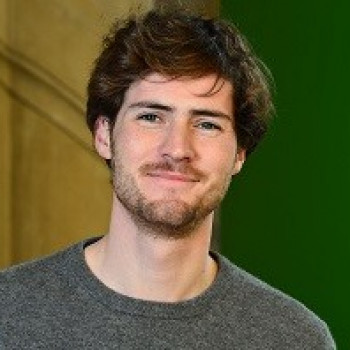Sebastian Sons: Die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss
Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH 2023
Sebastian Sons beschreibt die ‚Zeitenwende‘ der Golfstaaten, ihrer Gesellschaften und Eliten: Ambitioniert, geopolitisch flexibel, widersprüchlich und autoritär – so verlangten die an Einfluss gewinnenden golfarabischen Monarchien ihren westlichen Partnern in Fragen von außenpolitischer Zusammenarbeit für Energiepartnerschaften, Diplomatie oder Migration zunehmend eine langfristige strategische Herangehensweise ab, schreibt Sons. Unser Rezensent lobt, dass der Islam- und Politikwissenschaftler dabei mit „großer Sachkenntnis wie auch gut lesbar“ formuliert habe.