Robert Stüwe / Thomas Panayotopoulos: The Juncker Commission. Politicizing EU Policies
The Juncker Commission. Politicizing EU Policies
Baden-Baden, Nomos 2020
Als Jean-Claude Juncker 2014 zum Präsidenten der EU-Kommission gewählt wurde, kündigte er an, eine „politische“ Kommission zu führen und diese entsprechend umzugestalten. Hat er dieses Ziel tatsächlich verfolgt und wie weit ist er mit seinem Ansinnen gekommen? Antworten finden sich in dem von Robert Stüve und Thomas Panayotopoulos edierten Band. Das Fazit fällt positiv aus. Die Analysen der zehn Juncker-Prioritäten zeigen, dass der Luxemburger auf dem Weg hin zu einer politischeren Kommission in nur fünf Jahren erstaunlich viel erreicht und für seine Nachfolgerin eine Bresche geschlagen hat, so Rezensent Rainer Lisowski.
Die Europäische Union. Ein Modell unter Druck
... im Jahr 1970 hat sich das Europäische Parlament, wie es seit 1958 genannt wird, zu einem echten Ko-Gesetzgeber neben dem Ministerrat entwickelt. Abbildung 4 stellt die Anzahl der Regionalorganisatione ......Nutzung und Nutzen der „europäischen Säule sozialer Rechte“. Bestandsaufnahme und Empfehlungen

Weder ist die europäische Säule sozialer Rechte (ESSR) rechtsverbindlich noch hat ihre Einbindung in das Europäische Semester bislang Erfolge zur Stärkung der sozialen Dimension der EU erbracht. Um Jean-Claude Junckers Anspruch eines „sozialen ‚Triple-A‘“ für die EU gerecht zu werden, müssten die Grundsätze der ESSR aber über ein Sozialprotokoll zu einklagbaren Rechten werden. Solange dies nicht möglich ist, schreibt Björn Hacker, sollte in der Politikkoordinierung ihre Verbindlichkeit durch Mindeststandards gestärkt und für die Eurozone ein Sozialer Stabilitätspakt beschlossen werden.
Die Europäische Union demokratischer gestalten. Nationale Parlamente stärken oder eine EU-Staatsbürgerschaft einführen?
... g ändern. Sie plädieren dafür, dass die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedstaaten die dominante Rolle in der EU spielen. Deshalb möchten sie den Europäischen Rat und den Ministerrat stärken u ......Vorreiter oder Nachzügler? Die deutsche Energiewende im globalen Kontext

Die Welt befinde sich im Umbruch: Das Pariser Klimaabkommen habe den Beginn des fossilen Zeitalters eingeleitet, so die Energieökonomin Claudia Kemfert. Sie zeigt in ihrer Analyse, dass die skandinavischen Länder, die G7-, die BRICS- und andere Staaten der Welt allerdings noch in verschiedener Weise und mit unterschiedlichem Erfolg nach wirtschaftlichen Lösungen für den Einstieg in das Zeitalter der erneuerbaren Energien suchen. Für diese globale Transformation stelle aber die deutsche Energiewende ein wichtiges Vorbild dar.
Das Nationale versus das Europäische in der bulgarischen Gedächtniskultur. Zeitschichten konfliktreicher Erinnerungspraktiken
... z berechtige. Im Jahre 2003 erklärte der Ministerrat zu Ehren des 60. Jahrestags der Rettung der bulgarischen Juden den 10. März zum „Tag des Holocaust und derjenigen, die unter den Verbrechen geg ......Stefan Becker / Michael W. Bauer / Alfredo De Feo (Hrsg.): The New Politics of the European Union Budget
... insbesondere in den 1980er-Jahren, wurden Budgetfragen immer häufiger Gegenstand tiefer institutioneller Konflikte. Der Ministerrat und das Europäische Parlament waren beide mit der Verabschiedung des ......Klaus Weber / Henning Ottmann: Reshaping the European Union
Reshaping the European Union
Baden-Baden, Nomos Verlag 2018
Klaus Weber und Henning Ottmann präsentieren sowohl eine Bestandsaufnahme der EU als auch einen Entwurf für ihre künftige Entwicklung und legen dar, was die Hauptziele der EU sein sollten: die Sicherung des Friedens, die Förderung wirtschaftlichen Wohlstands, die Kompensation der relativ geringen Größe und Macht der einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Beachtung westlicher Zivilisationswerte. Gleichzeitig formulieren sie jedoch den klaren Umkehrschluss, nämlich dass sich die EU auf diese Ziele beschränken und nicht rein teleologisch motiviert eine immer engere Union anstreben sollte.
Nordirland: Das Ende vom Lied? Der Friedensprozess und der Brexit

Ein 2019 anstehender Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union wirft Schatten auf die ohnehin labile Lage des Friedensarrangements in Nordirland, der britischen Exklave im Nordosten der irischen Insel. Bernhard Moltmann skizziert in seiner Analyse Ansatz, Rahmenbedingungen und Verlauf des nordirischen Friedensprozesses bis hin zu Symptomen seines Zerfalls. Anschließend umreißt er die Herausforderungen, die ein Brexit dem Erhalt friedlicher Verhältnisse in Nordirland auferlegt.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Ostdeutschland. Entstehung und Entwicklung
... konnte, wenn ihre politischen Auffassungen und Ziele denen der SED entsprachen. Der Ministerrat entschied über die Asylgewährung. Es handelte sich also nicht um Rechtsgrundsätze, sondern um politisch ......Der Konsens schwindet. Die EU verliert an Handlungsfähigkeit
... selbst hat sie zur Verlagerung von Entscheidungsmacht auf die intergouvernementalen Organe geführt, den Ministerrat (im Folgenden als Rat bezeichnet) sowie den Europäischen Rat, in denen die Regierungen ......Matthias Lemke: Ausnahmezustände in der V. Französischen Republik. Über die politische Plausibilisierung der Normsuspendierung
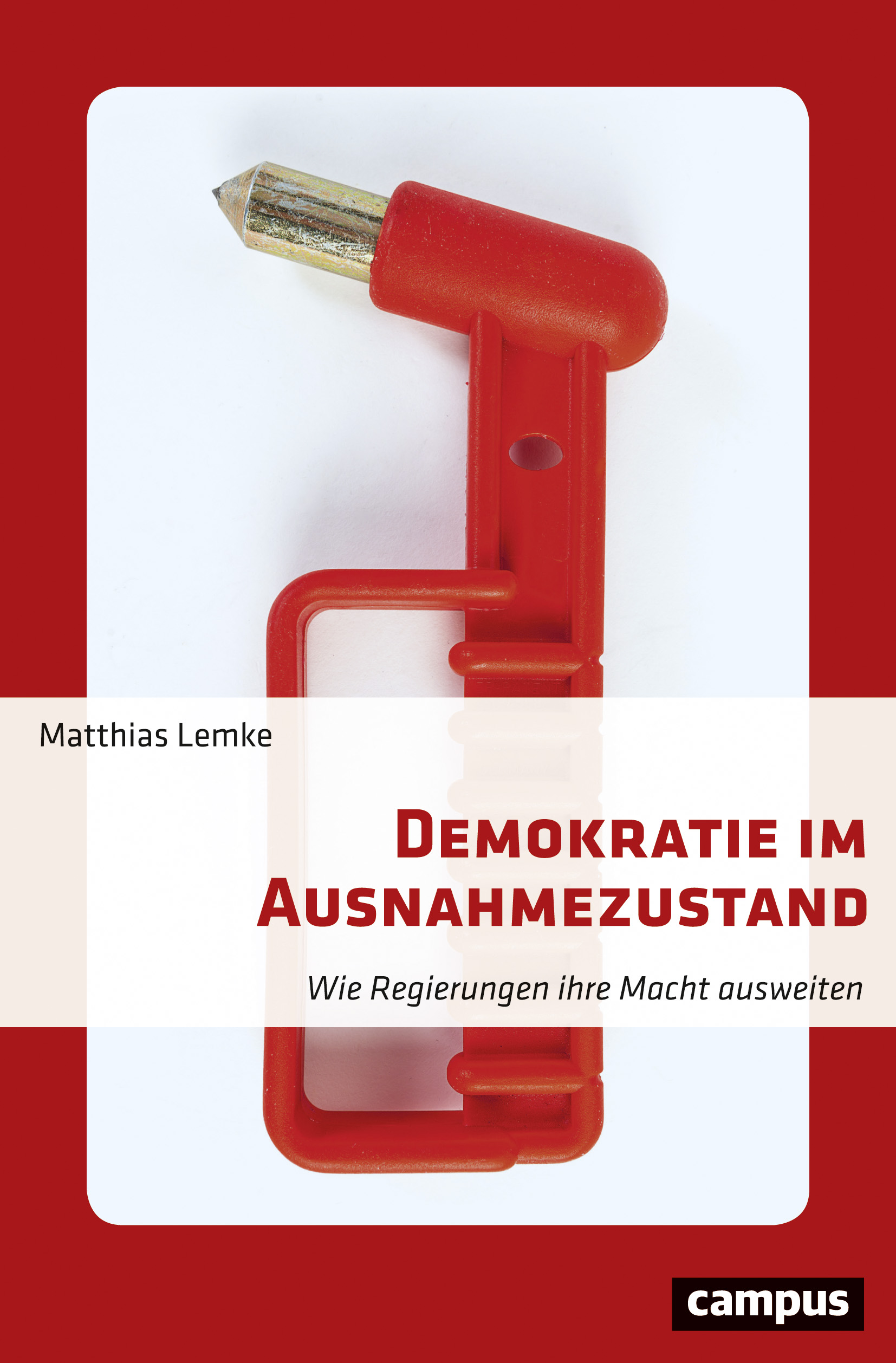
Der Versuch, das Unbestimmte in das Prinzip des rule of law der französischen Republik einzuschreiben, hat sich in drei nationalen Rechtsnormen niedergeschlagen, wie Matthias Lemke in seiner Analyse schreibt. Dieses Ensemble liefert die verfahrenspraktische Grundlage für die Normsuspendierung durch die Exekutive. Seit dem Algerienkrieg konnte die Regierung so wiederholt die Deutungs- und Handlungsmacht an sich ziehen. Der gegenwärtige Ausnahmezustand im Kampf gegen den Terrorismus gilt vorerst bis zum 15. Juli 2017.