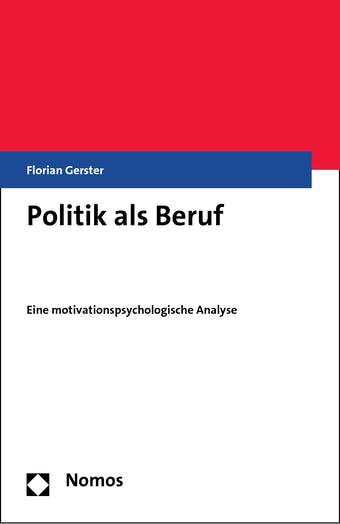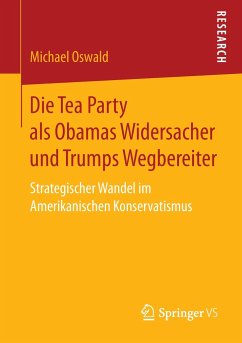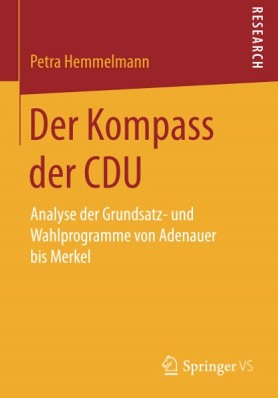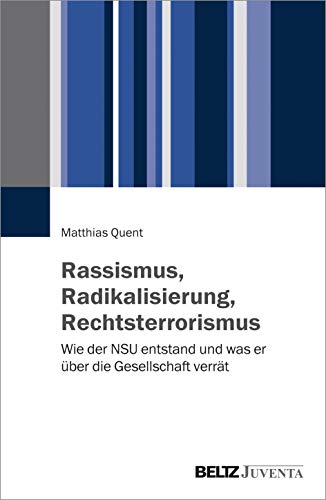Florian Gerster: Politik als Beruf. Eine motivationspsychologische Analyse
Was bewegt Menschen, die Politik zum Beruf zu machen? Steht hinter der Entscheidung für die Politik ein zentrales Motiv oder aber „ein Motivcluster mit bewussten und unbewussten, expliziten und impliziten Anteilen“? Dieser Frage geht Florian Gerster, der selbst dreißig Jahre Berufspolitiker war, in seiner empirisch gestützten Dissertation anhand von zehn Fallbeispielen nach. Er geht davon aus, dass Leistung, Anschluss und Macht entscheidende Gründe sind. Das Machtmotiv sei am stärksten ausgeprägt, das Bedürfnis nach sozialem Anschluss hingegen nachrangig.
Michael Oswald: Die Tea Party als Obamas Widersacher und Trumps Wegbereiter. Strategischer Wandel im Amerikanischen Konservatismus
Die Tea Party nimmt für sich in Anspruch, eine Graswurzelbewegung zu sein. Michael Oswald kommt in seiner Dissertation zu einer gegenteiligen Diagnose: Trotz einer durchaus beträchtlichen Binnenheterogenität handelt es sich um eine strategisch aufgebaute Protestbewegung, gesteuert von einem sendungsbewussten Netzwerk aus superreichen Financiers, Medienakteuren wie Fox News und konservativen Thinktanks. Der in ihrer Blütezeit amtierende Präsident Obama sei – mit rassistischen Untertönen – als Sozialist diffamiert und der gesamte Diskurs in der Republikanischen Partei nach rechts verschoben worden.
Petra Hemmelmann: Der Kompass der CDU. Analyse der Grundsatz- und Wahlprogramme von Adenauer bis Merkel
Der Vorwurf wankelmütiger Prinzipienlosigkeit ist stete Begleitmusik der Kanzlerschaft Angela Merkels. Die CDU-Chefin, argwöhnen Kritiker, suche ihr Heil stets im taktierenden Abwarten und gebe im Zweifelsfall auch eherne Grundüberzeugungen ihrer Partei preis, wenn dies nur dem Machterhalt diene. Aber hat die CDU unter Merkel tatsächlich ihr programmatisches Profil verloren? Petra Hemmelmann analysiert die Programmatik der Partei seit ihrer Gründung und kann nicht feststellen, dass sie mit ihrem Wertekanon gebrochen habe. Auch sei die CDU keineswegs nur ein Kanzler(in)wahlverein.
Matthias Quent: Rassismus, Radikalisierung, Rechtsterrorismus. Wie der NSU entstand und was er über die Gesellschaft verrät
Matthias Quent trägt mit seiner Dissertation zur Aufklärung über die Radikalisierung des Rechtsextremismus bei, die in den Morden des NSU kulminierte. Bislang sei die Frage, welchen sinnstiftenden Rationalitäten diese Terrorgruppe folgte, wissenschaftlich nicht ausreichend beantwortet. Quent entwirft ein Pyramidenmodell der Radikalisierung, mit dem auch die Bedeutung der Sympathisanten berücksichtigt wird. Die Taten des NSU deutet er als einen vigilantistischen Terrorismus, der sich rassistisch rechtfertigt.