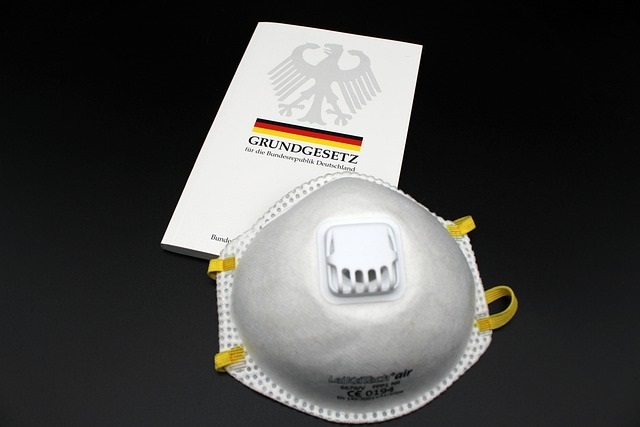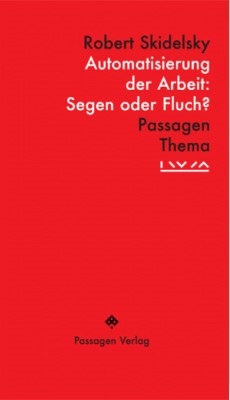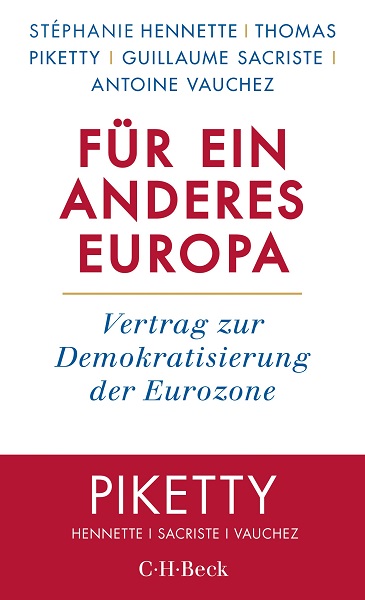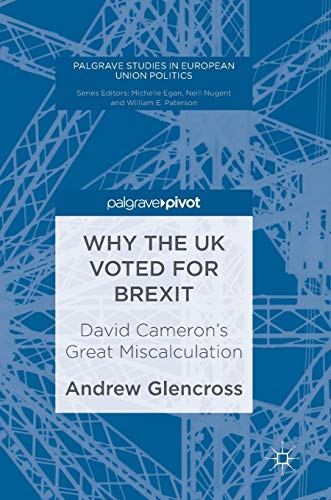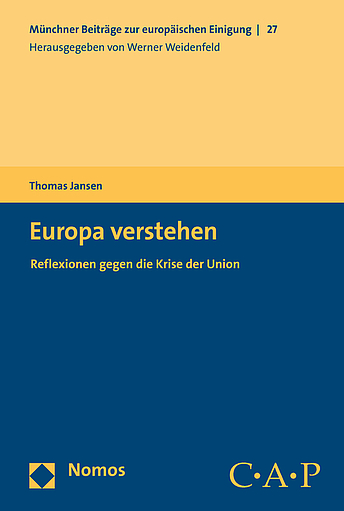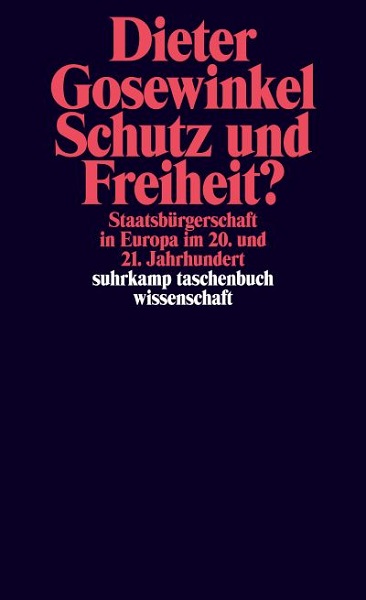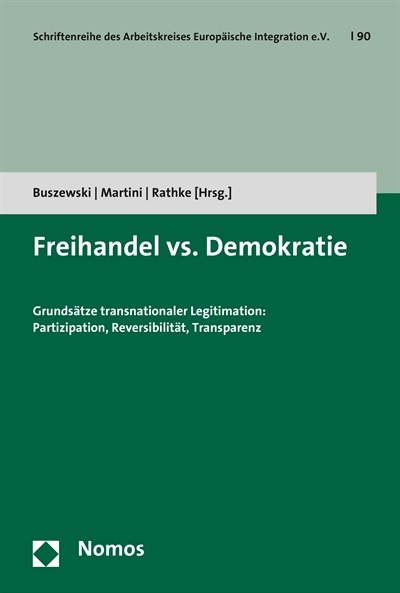Victor D. Cha, Ramon Pacheco Pardo: Korea. A New History of South and North
Den Politikwissenschaftlern Victor D. Cha und Ramon Pacheco Pardo ist es laut unserem Rezensenten Max Lüggert gelungen, eine kompakte und zugleich umfassende Einführung in die Geschichte Koreas der letzten 150 Jahre zu geben. Dabei steht die seit den 1950ern bestehende Teilung des Landes im Vordergrund. Neben Unterschieden und Ähnlichkeiten der Entwicklung beider Koreas nehmen die Autoren auch das Potenzial einer Wiedervereinigung unter den heutigen geopolitischen Voraussetzungen in den Blick und geben einen Ausblick darauf, welche Hürden ein vereintes Korea zu überwinden hätte.
Samira Akbarian: Ziviler Ungehorsam als Verfassungsinterpretation
Ziviler Ungehorsam ist im Rahmen der Klimaproteste als Aktionsmodus politischer Bewegungen in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert worden. Handelt es sich um einen legitimen politischen Protest oder um bloßen Rechtsbruch? Samira Akbarian hat sich mit dieser Frage rechtstheoretisch in ihrer Dissertation auseinandergesetzt. Dabei argumentiert sie, dass ziviler Ungehorsam nicht im Widerspruch mit der repräsentativen Demokratie steht, sondern als Ergänzung zu ihr betrachtet werden sollte - und liefert damit laut unserem Rezensenten Max Lüggert ein erfreulich praxisbezogenes Buch.
Patrick A. Mello, Falk Ostermann (Hrsg.): Routledge Handbook of Foreign Policy Analysis Methods
Das Forschungsfeld der Außenpolitikanalyse umfasst eine Fülle an methodischen Herangehensweisen, die Patrick A. Mello und Falk Ostermann nun in einem Handbuch gesammelt haben: Die Spannweite dieser Beiträge erstreckt sich von feministischer Außenpolitikanalyse über Frameanalysen bis hin zu quantitativen Ansätzen. Unser Rezensent Max Lüggert sieht hierin eine gelungene Sammlung der wichtigsten Forschungsmethoden in diesem Feld, merkt aber auch kritisch an, dass die Autorinnen und Autoren selbstkritisch die Grenzen der einzelnen Ansätze besser hätten hervorheben können.
Leon Wansleben: The Rise of Central Banks. State Power in Financial Capitalism
Die politische Bedeutung von Zentralbanken ist in der Eurokrise sowie spätestens während der Inflation infolge des Ukrainekriegs zu einem Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung geworden. Dahinter steht jedoch eine jahrzehntelange Entwicklung, wie Leon Wansleben in „The Rise of Central Banks“ zeigt. Während er diese nachzeichnet, geht er insbesondere auf die Auswirkungen der Zentralbankpolitik auf die Struktur des Finanzsektors ein. Max Lüggert hebt diese Leistung in seiner Rezension positiv hervor, hätte sich jedoch gewünscht, dass der Autor insbesondere die Rolle der Europäischen Zentralbank stärker einbezogen und seine Analysen angesichts aktueller Entwicklungen zu konkreten Vorschlägen weiterentwickelt hätte.
Michael L. Hughes: Embracing Democracy in Modern Germany. Political Citizenship and Participation, 1871-2000
Michael L. Hughes schildert ausführlich, wie sich die Demokratie in Deutschland zwischen 1871 und 2000 entwickelt hat. Dabei geht er chronologisch vor und beschreibt ihre wechselvolle Geschichte vom Kaiserreich über die Weimarer Republik und die nationalsozialistische Diktatur bis hin zur Teilung Deutschlands und schließlich zur Wiedervereinigung. Dabei stehen insbesondere Fragen der politischen Partizipation sowie die Besonderheiten der jeweiligen Staatsformen im Vordergrund. Das Buch sei solide recherchiert, liefere aber wenig neue Erkenntnisse, so ein Fazit der vorliegenden Rezension.
Lucio Baccaro, Mark Blyth, Jonas Pontusson (Hrsg.): Diminishing Returns. The New Politics of Growth and Stagnation
Der Sammelband blickt mittels internationaler Fallbeispiele auf das Phänomen wirtschaftlicher Stagnation und auf die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung: Von China über Europa bis hin zu den Vereinigten Staaten werden hierbei strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen akuter Krisen sowie jeweilige volkswirtschaftliche Unterschiede und Entwicklungslinien beleuchtet. Kleiner Wehmutstropfen bei der Lektüre, so unser Rezensent Max Lüggert: Das dabei zusammengetragene Wissen erschließe sich in einigen Beiträgen zunächst vor allem fachlich bereits versierten Leser*innen.
Karin Fischer / Margarete Grandner (Hrsg.): Globale Ungleichheit. Über Zusammenhänge von Kolonialismus, Arbeitsverhältnissen und Naturverbrauch
Die Autor*innen untersuchen hier facettenreich die Strukturen und Formen globaler Ungleichheit, so Max Lüggert in seiner Rezension: Konkret umfasse dies Fragen von Einkommen und Vermögen, Lebenschancen und Wiedergutmachung sowie ihre Relation zu internationaler Arbeitsteilung, Finanzmarktkapitalismus und Rassismus. Dabei erschöpfe sich die Kapitalismus- und Kolonialismuskritik nicht in redlichen Appellen. Fallbeispiele zeigten vielmehr fundiert problematische Entwicklungen der gegenwärtigen Weltwirtschaft auf und dies auch vor dem Hintergrund von Klima und Ressourcenendlichkeit.
Alexander von Pechmann: Die Eigentumsfrage im 21. Jahrhundert. Ein rechtsphilosophischer Traktat über die Zukunft der Menschheit
Alexander von Pechmann dekonstruiert unsere modernen Eigentumsordnungen, ihre Genese, ihre Rechtfertigungsstrategien und ihre Effekte. Dabei fragt der Philosoph insbesondere nach den Konsequenzen eines Status quo in der Eigentumsfrage, während sich die Welt global ökologisch wie demografisch rasant verändere. Er skizziert dabei Herausforderungen und Lösungsansätze. Die Analyse, so Max Lüggert, liefere den Stoff, um diese wichtige Auseinandersetzung gedanklich zu führen: beispielsweise in Form der Forderung nach einer stärker bindenden Formulierung zum Allgemeinwohl im Artikel 14 des Grundgesetzes.
Probleme in demokratischen Systemen. Ursachen für ihre Transformation in Autokratien
In seiner Doppelrezension bespricht Max Lüggert mit „After Democracy“ von Zizi Papacharissi und „Popular Dictatorships“ von Aleksandar Matovski zwei Bücher, die sich mit der Demokratie und ihren Herausforderungen beschäftigen. „After Democracy“ komprimiert persönliche Gespräche, die Papacharissi in verschiedenen Ländern mit Menschen zum Thema Demokratie und Staatsbürgerschaft geführt hat, in einem Buch. „Popular Dictatorships“ befasst sich mit der Transformation von Demokratien zu autokratischen Systemen und den Gründen für die innere Stabilität solcher „Wahlautokratien“.
Beschränkungen von Grundrechten in der Pandemie
Rezensent Max Lüggert nimmt zwei Publikationen in den Blick, in denen die Beschränkungen von Grundrechten in der Pandemie thematisiert werden. Während es um deren politischen Folgen aus staatsrechtlicher Sicht in dem von Robert van Ooyen und Hendrik Wassermann edierten Beiheft zur Zeitschrift Recht und Politik „Corona und Grundgesetz“ geht, präsentieren Hannes Hofbauer und Stefan Kraft in dem von ihnen herausgegebenen Sammelband „Herrschaft der Angst“ eine umfassendere Kritik an den Corona-Maßnahmen. Sie sehen, so Lüggert, „in der pandemischen Situation einen Moment, in dem politische und mediale Eliten gezielt Angst erzeugen, um neue Regeln zu erlassen".
Robert Skidelsky: Automatisierung der Arbeit: Segen oder Fluch?
Die Debatte über die Entwicklung von automatisierten Arbeitsprozessen und den Einsatz künstlicher Intelligenz sowie der damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen wird äußerst kontrovers geführt. Der britische Wirtschaftshistoriker Robert Skidelsky bietet hierzu einige gedankliche Anstöße. In vier Essays befasst er sich mit der Idee von einer Zukunft ohne Arbeit sowie den anthropologischen Vorstellungen einiger Verfechter von künstlicher Intelligenz. Weitere Themen sind Arbeitszeitverkürzungen und die Abfederung möglicher prekärer Entwicklungen.
Katrin Verena Franz: Das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag – Architektur eines organschaftlichen Rechts
Aus einer eher selten vertretenen Sichtweise betrachtet Katrin Verena Franz in ihrer Dissertation das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag, nämlich als „organschaftliches Recht“. Dieser Begriff ist insbesondere als Gegenentwurf zu einem individualrechtlichen Wahlrechtsverständnis zu sehen, das die Autorin einer umfassenden Kritik unterzieht. Darauf aufbauend begründet sie, weshalb das Wahlrecht nicht den einzelnen Wahlbürger*innen zugeordnet werden sollte, sondern stattdessen als ein Recht zu verstehen ist, welches das wahlberechtigte Volk kollektiv als Staatsorgan ausübt.
Stefan Becker / Michael W. Bauer / Alfredo De Feo (Hrsg.): The New Politics of the European Union Budget
Die europäische Integration ist in ihrer Entwicklung eng an das Budget der EU gebunden, das zu drei Vierteln von den Mitgliedstaaten aufgebracht wird. Kurz vor dem Brexit, mit dem einer der größten Beitragszahler die Union verlassen wird, und vor dem Ablauf des mehrjährigen Finanzrahmens liegt mit „The New Politics of the European Union Budget” eine Artikelsammlung vor, mit der die Bedeutung des Budgets und aktuelle Diskussionen gespiegelt werden. Dabei wird unter anderem die Regelung, dass sich die Mitgliedstaaten einstimmig über den Haushalt einigen müssen, kritisch hinterfragt.
Alexander Schellinger / Philipp Steinberg (Hrsg.): Die Zukunft der Eurozone. Wie wir den Euro retten und Europa zusammenhalten
Alexander Schellinger und Philipp Steinberg legen einen Sammelband vor, in dem die Resultate eines Studienprojektes der Friedrich-Ebert-Stiftung zur weiteren Entwicklung der Eurozone zusammengefasst sind. Die Herausgeber verstehen die Eurokrise nicht nur als wirtschaftliche, sondern auch als politische und soziale Krise, weshalb eine alleinige Milderung der volkswirtschaftlichen Krisensymptome nicht zu einer Stabilisierung der EU führen werde. Sie betonen, dass die EU auch eine soziale Dimension annehmen müsse. Die Autor*innen zeigen auf, wie eine Reform der EU gelingen könnte.
Klaus Weber / Henning Ottmann: Reshaping the European Union
Klaus Weber und Henning Ottmann präsentieren sowohl eine Bestandsaufnahme der EU als auch einen Entwurf für ihre künftige Entwicklung und legen dar, was die Hauptziele der EU sein sollten: die Sicherung des Friedens, die Förderung wirtschaftlichen Wohlstands, die Kompensation der relativ geringen Größe und Macht der einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Beachtung westlicher Zivilisationswerte. Gleichzeitig formulieren sie jedoch den klaren Umkehrschluss, nämlich dass sich die EU auf diese Ziele beschränken und nicht rein teleologisch motiviert eine immer engere Union anstreben sollte.
Christian Koenig / Ludger Kühnhardt (Hrsg.): Governance and Regulation in the European Union. A Reader
Am Zentrum für Europäische Integrationsforschung an der Universität Bonn wird das regulatorische Wirken der EU erforscht, angeboten wird zu dieser Thematik auch ein postgradualer Studiengang. Unter der Herausgeberschaft von Christian Koenig und Ludger Kühnhardt ist nun ein Lesebuch zu den Forschungsergebnissen erschienen. Der Einfluss der EU auf die Politik im Allgemeinen und die Regulierung im Besonderen wird beispielhaft etwa mit Blick auf das transatlantische Verhältnis, auf die Rolle der Europäischen Zentralbank oder hinsichtlich der Regulierungen im Eisenbahnsektor aufgezeigt.
Stéphanie Hennette / Thomas Piketty / Guillaume Sacriste / Antoine Vauchez: Für ein anderes Europa. Vertrag zur Demokratisierung der Eurozone
Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste und Antoine Vauchez fordern eine demokratische Erneuerung der Eurozone, denn die institutionellen Änderungen seien bisher nicht ausreichend demokratisch unterfüttert worden: Die Eurogruppe – das Gremium der Finanzminister – habe sich zu einem schwarzen Loch der Demokratie entwickelt. Um die demokratische Kontrolle der europäischen Wirtschaftspolitik zu stärken, schlagen die Autor*innen einen „Vertrag zur Demokratisierung der Eurozone“ vor. Sein Kernstück ist die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung für die Eurozone.
Andrew Glencross: Why the UK Voted for Brexit. David Cameron's Great Miscalculation
Andrew Glencross legt einen ersten handlichen Bericht über die Ursachen, Hintergründe und möglichen Konsequenzen des Brexits vor, wobei er die missglückte Politik des damaligen Premierministers David Cameron in den Mittelpunkt rückt: Nach zwei anderen Referenden, auf deren Abstimmung er in seinem Sinne politisch einzuwirken wusste, verkalkulierte er sich. Cameron übersah, dass ein Brexit längst Teil der öffentlichen Debatte war, angefacht durch Ängste in der Bevölkerung vor einer ungeregelten Immigration. Zugleich stand er innerparteilichen Gegnern, die die EU ablehnten, gegenüber. Abschließend lädt Glencross zu einem Nachdenken über Nutzen und Grenzen direkter Demokratie ein.
Die Erfolgsrezepte der Rechtspopulisten. Diskursive Annäherungen anhand der Beispiele Schweiz und Niederlande

Warum gelingt es rechtspopulistischen Parteien in Europa, Wähler*innen zu mobilisieren und öffentliche Debatten zu beeinflussen? Zwei Bücher geben Aufschluss: „Rechtspopulismus und Hegemonie“ von Marius Hildebrand sowie „Rechtspopulismus im Spiegel der niederländischen Presse“ von André Krause.
Thomas Jansen: Europa verstehen. Reflexionen gegen die Krise der Union
Die öffentliche Wahrnehmung der Europäischen Union ist immer wieder durch Krisendiagnosen bestimmt – in besonderem Maße in den vergangenen Jahren. Ausgehend von dieser Einschätzung hat der erfahrene Europapolitiker Thomas Jansen ein Buch vorgelegt, in dem er sich mit diesen Krisen befasst und sie in einen größeren Kontext einordnet. Abgerundet wird die Analyse durch die konkrete Vision einer Europäischen Föderation. Nach Meinung des Rezensenten spiegelt sich in dem Buch eine europäische Biografie; bedauerlich sei allein die ausschließlich konservative Perspektive des Autors.
Karin Böttger / Mathias Jopp (Hrsg.): Handbuch zur deutschen Europapolitik
Die Europäische Union beeinflusst mittlerweile weite Teile des politischen Alltags, auch in Deutschland. Dies wurde in jüngster Zeit besonders bei den Migrationsbewegungen und der Eurokrise offensichtlich, zeigt sich aber auch an fortlaufenden gemeinsamen Herausforderungen in Bereichen wie der Energie-, Handels- und Sicherheitspolitik. Katrin Böttger und Mathias Jopp verfolgen mit ihrem Handbuch das explizite Ziel, „in Zeiten wachsender Europaskepsis“ (13) die Bedeutung der europäischen Integration für Deutschland herauszuarbeiten.
Dieter Gosewinkel: Schutz und Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert
Für jedes politische Gemeinwesen stellt sich grundlegend die Frage nach der Zugehörigkeit. Bevor sich politische Institutionen, Angelpunkte staatlicher Gewalt und rechtliche Grundlagen wirksam materialisieren können, ist zu klären, welche Personen überhaupt als Mitglieder eines Gemeinwesens gelten. Dies geschieht seit der politischen Moderne meistens über die rechtliche Figur der Staatsbürgerschaft. Dieter Gosewinkel hat ein umfassendes Werk vorgelegt, in dem er die Entwicklung der Staatsbürgerschaft in den vergangenen anderthalb Jahrhunderten rekonstruiert, wobei er sich im Besonderen auf die Situation in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland beziehungsweise der Sowjetunion konzentriert.
Sinthiou Buszewski / Stefan Martini / Hannes Rathke (Hrsg.): Freihandel vs. Demokratie. Grundsätze transnationaler Legitimation: Partizipation, Reversibilität, Transparenz
Die Debatte über die geplanten zwei großen Handelsabkommen der Europäischen Union mit Kanada (CETA) und den Vereinigten Staaten (TTIP) hatte bis zum Zeitpunkt der Präsidentschaftswahl in den USA eine Präsenz und Vielstimmigkeit erreicht, wie man dies zuvor von ähnlichen Handelsabkommen nicht gewohnt gewesen ist. Viel stärker sind auch grundlegende Fragen in den Vordergrund getreten, allen voran jene, ob durch solche Abkommen grundsätzliche Charakteristika demokratischer Politik wie Partizipation, Transparenz und Reversibilität beschränkt, wenn nicht gar vollständig aufgehoben werden.