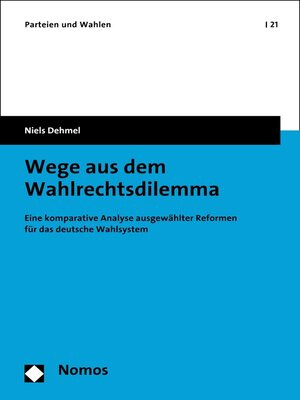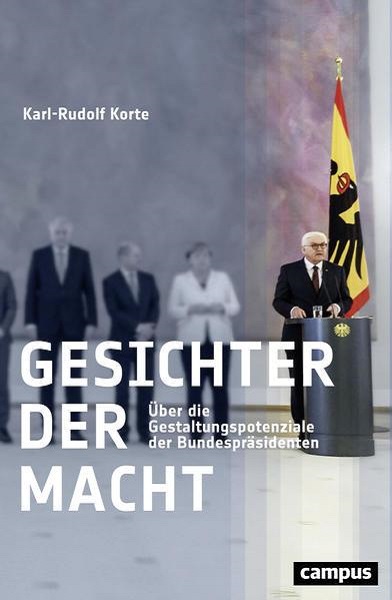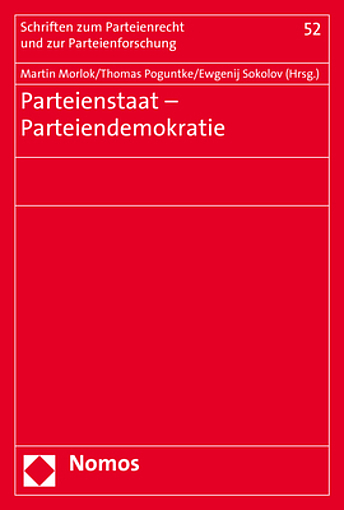Foto © IParl
Isabela Mares: Protecting the ballot. How First-Wave Democracies ended electoral corruptions
Isabela Mares untersucht, wie es Frankreich, Deutschland, Belgien und Großbritannien zwischen 1850 und 1918 gelang, Wahlreformen einzuführen, die Wahlfälschungen reduzierten. Anhand parlamentarischer Debatten und namentlicher Abstimmungen zeigt sie, dass es neben einer demokratischen Grundüberzeugung vor allem wahltaktische Überlegungen sowie Ressourcen- und Machtfragen waren, die Abgeordnete dazu bewogen, Wahlrechtsreformen zu unterstützen. Damit wirft das Buch auch ein Licht auf die Möglichkeiten und Hindernisse, Wahlunregelmäßigkeiten in jungen Demokratien einzudämmen.
Referendum – Neverendum? Wie britischer Parlamentarismus und Referenden zusammengehen
Großbritannien ist das Mutterland des Parlamentarismus und trotzdem finden dort immer wieder auch Referenden, also Formen direkter Demokratie; statt. 2011 wurde über eine Änderung des Wahlsystems, 2014 über die schottische Unabhängigkeit und 2016 über den Brexit abgestimmt. Mit Melanie Sully, gebürtige Britin und Direktorin des österreichischen Go-Governance-Instituts, besprechen wir den Stand des Parlamentarismus in Großbritannien und wie repräsentative und direkte Demokratie miteinander einhergehen können.
Berlin’s Extraordinary Election. Flaws, Failures, and Their Consequences
Die Berlinwahl 2023 findet statt. Zuletzt lehnte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen die Wiederholung ab. Daniel Hellmann vom Institut für Parlamentarismusforschung (IParl) hat die Ereignisse in Berlin rund um die Wahlwiederholung in englischer Sprache für The American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) zusammengefasst.Folge 17: „Politikwissenschaft als Partnerin der Demokratie“: Leben und Wirken von Eberhard Schütt-Wetschky

Zwischenruf - Der politikwissenschaftliche Podcast rund ums Parlament. Grundlegend, realitätsgerecht, praxisnah. Bild: IParl, Berlin.
Die Stiftung Wissenschaft und Demokratie (SWuD) feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. In dieser Folge des IParl-Podcasts „Zwischenruf“ geht es darum, mit welchen politikwissenschaftlichen Fragestellungen Eberhard Schütt-Wetschkys die Stiftung gründete: Worin besteht die Arbeit der Politikwissenschaft in Demokratien? Und wie gelingen Repräsentation und Parlamentarismus im täglichen Regierungsgeschäft? Darüber spricht Daniel Hellmann nun mit Dr. Astrid Kuhn und Dr. Sebastian Galka sowie mit Prof. Dr. Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel (ISPK) und Prof. Dr. Suzanne S. Schüttemeyer vom Berliner Institut für Parlamentarismusforschung (IParl).
Daniel Hellmann / Danny Schindler: Kein Anzeichen von Niedergang. Die personelle Erneuerung der Parteien bei der Kandidatenaufstellung für Bundestags- und Landtagswahlen
Seit etwa 30 Jahren verzeichneten Parteien hierzulande einen Rückgang ihrer Mitgliedzahlen. Ob dies indes mit einem Mangel an politisch interessierten Nachwuchskräften gleichzusetzen ist, verneinen Daniel Hellmann und Danny Schindler in dieser Analyse. Sie stellen Daten aus dem CandiData-Projekt des Instituts für Parlamentarismusforschung (IParl) vor: Diese zeigen, dass die Parteien nachweislich viele neue Menschen für eine Nominierung gewinnen können. Daraus ergeben sich spannende Fragestellungen zur Praxis der Kandidatenaufstellung von politischen Neulingen bei Wahlen auf Landes- und Bundesebene.
Michael Krennerich: Free and fair elections. Standards, Curiosities, Manipulations
In seinem Buch „Free and fair elections. Standards, Curiosities, Manipulations“, das Daniel Hellmann rezensiert hat, beschäftigt sich Michael Krennerich mit den unterschiedlichen Ausprägungen, die Wahlen annehmen können. Das Werk hält, was der Titel verspricht: Darin werden internationale Standards, Manipulationsmöglichkeiten und Kuriositäten im Zusammenhang mit Wahlen übersichtlich aufbereitet. Krennerich präsentiert insgesamt ein gut lesbares und mit anschaulichen Beispielen gespicktes Buch, das ein facettenreiches Bild unterschiedlicher Wahlpraktiken zeichnet.
Peggy Matauscheck: Wahlsystemreform in Deutschland. Plädoyer für ein Prämienwahlsystem mit Koalitionsbonus
Peggy Matauschek diskutiert Vorschläge für eine grundlegende Reform des Bundestagswahlrechts und plädiert für seine Weiterentwicklung hin zu einem Mehrheitswahlsystem. Aus Sicht des Rezensenten Daniel Hellmann blickt Matauschek dadurch aus einer "selten eigenommenen Perspektive?“ auf die Wahlrechtsreform. Gänzlich überzeugt ist er aber nicht: Immerhin basierten Matauscheks Vorschläge auf der Überzeugung, dass das geltende Wahlrecht keine hinreichende Konzentrationsleistung erbringe und damit die Regierungsbildung entscheidend beeinträchtige. Diese Ansicht werde aber nur von wenigen Forschenden vertreten.
Niels Dehmel: Wege aus dem Wahlrechtsdilemma. Eine komparative Analyse ausgewählter Reformen für das deutsche Wahlsystem
Das deutsche Wahlrecht befinde sich in einem Reformdilemma, weshalb Niels Dehmel Verbesserungspotenziale auslotet und schließlich zwei Lösungsoptionen erwägt: eine verständlichkeits- und eine beteiligungsorientierte personalisierte Verhältniswahl. Erstere würde das Zweistimmen- in ein Einstimmensystem mit Nebenstimme umwandeln. Dehmels zweite Reformoption sei insofern beteiligungsorientiert als sie die bislang geschlossenen Listen der Parteien öffne, sodass nicht nur die Liste an sich, sondern einzelne Personen auf der Liste bevorzugt gewählt werden könnten, schreibt Rezensent Daniel Hellmann.
Aus gegebenem Anlass: Wählen per Brief in Deutschland. Wie fehleranfällig ist die Briefwahl?

Daniel Hellmann fragt, ob die zu erwartende Ausweitung der Briefwahlen im Superwahljahr 2021 zu Problemen führen könnte. Für diese Annahme gebe es keine Anhaltspunkte. Weder seien Briefwahlstimmen häufiger ungültig, noch würden die Wahleinsprüche gegen die Bundestagswahl seit 1990 Anlass geben, strukturelle Probleme beim Wählen per Brief zu vermuten. Dennoch gebe es Verbesserungspotenziale, wie etwa: bessere Absprachen mit externen Dienstleistungsunternehmen, mehr Personal für die Gemeinden oder eine zentralisierte Materialbeschaffung, die die Briefwahl zukünftig noch sicherer machen können.
Martin Reiher: Parlamentarier als Beruf. Rekrutierungswege und politische Karrieren am Beispiel des Deutschen Bundestages
Wie wird man Abgeordneter? Mit dieser zentralen Frage nach den Rekrutierungswegen von Parlamentariern beschäftigt sich Martin Reiher, der aus einer abgeordnetenzentrierten Perspektive nach Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Entwicklungen von Karrierepfaden und Merkmalen der Professionalisierung des Abgeordnetenmandats sucht. Entsprechend stellt er die von verschiedenen Politikwissenschaftlern entworfenen Karrieretypologien dar und entwirft eine eigene Kategorisierung. Dabei zeigt sich, dass die Rekrutierungspfade über die Jahre hinweg erstaunlich stabil sind.
Susanne Reitmair-Juárez / Kathrin Stainer-Hämmerle (Hrsg.): Demokratie und Wahlrecht als Themen der politischen Bildung
Wie lassen sich demokratische Werte und Bürgersinn durch politische Bildungsarbeit forcieren? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Bandes, der die Beiträge zweier Jahrestagungen der Interessengemeinschaft Politische Bildung umfasst. Neben eher theoretisch-konzeptionellen Aufsätzen zu historischen und aktuellen Fragen von Partizipation und Repräsentation sind auch einige praxisbezogene Beiträge mit Anregungen für die schulische Demokratieerziehung sowie die außerschulische politische Bildungsarbeit enthalten.
Karl-Rudolf Korte: Gesichter der Macht. Über die Gestaltungspotenziale der Bundespräsidenten. Ein Essay
Was macht der Bundespräsident eigentlich? Und: Kann er überhaupt etwas ausrichten? Karl-Rudolf Korte bietet eine anschauliche und detailreiche Schilderung des mit diesem Amt verbundenen Arbeitsalltags. Vor allem geht es ihm darum aufzuzeigen, was der Bundespräsident wie bewirken kann sowie auf die zahlreichen Ambivalenzen des Amtes hinzuweisen. So ist die größte Machtressource des Bundespräsidenten das Wort, beispielsweise in Form mahnender Reden, die aber nur dann Wirkung hat, wenn sie sparsam genutzt wird.
Lars Holtkamp: Der Parteienstreit. Probleme und Reformen der Parteiendemokratie
Das an eine breite Öffentlichkeit gerichtete Buch bietet einen kritischen Blick auf die Parteiendemokratie in Deutschland. Lars Holtkamp entwirft dabei einen parteipolitischen Repräsentationszyklus und identifiziert in allen Phasen Schwachstellen: So schwinde die gesellschaftliche Verankerung der Parteien, der Lobbyismus erstarke und die Fähigkeit zur politischen Steuerung nehme ab. Holtkamp wirft zudem der klassischen Parteienforschung eine weitgehende Kritiklosigkeit vor. Diesem Vorwurf aber mag Daniel Hellmann in seiner Rezension nicht folgen, zudem sei die empirische Anbindung der Thesen zu schwach.
Karl-Rudolf Korte / Dennis Michels / Jan Schoofs / Niko Switek / Kristina Weissenbach: Parteiendemokratie in Bewegung. Organisations- und Entscheidungsmuster der deutschen Parteien im Vergleich
Der Band „Parteiendemokratie in Bewegung“ erscheint zum Abschluss der Reihe „Die politischen Parteien der Bundesrepublik Deutschland“. Die Einzelbefunde werden verknüpft und dabei wird noch einmal im Überblick ein präziser Blick auf das Innenleben und das Umfeld von Parteien geworfen. Die Autor*innen wählen dafür einen mikropolitischen Ansatz und brechen dabei durch viele Beispiele die abstrakten theoretischen Argumentationen auf alltagsweltliche Erfahrungen herunter. Allerdings fehlen Reihe wie Band eine Analyse der Entscheidungsfindung der AfD, wollte diese doch alles anders machen.
Martin Morlok / Thomas Poguntke / Ewgenij Sokolov: Parteienstaat - Parteiendemokratie
Mit diesem Tagungsband wird aus politik- und rechtswissenschaftlicher Perspektive eine Vielzahl an Themen der Parteienforschung beleuchtet. Neben generellen Einschätzungen zur Rolle der Partei im politischen Gesamtgefüge und der Möglichkeit, mit einer Ausweitung direktdemokratischer Elemente Partei und Volk wieder stärker zu verkoppeln, geht es um konkrete Einzelfragen. Dazu zählen beispielsweise die Trennung von Partei und Fraktion, die Bedeutung des freien Mandats und die Rolle der Urwahl für die innerparteiliche Demokratie. Auch wird auf die politische Praxis der Piratenpartei zurückgeblickt.
Joachim Behnke / Frank Decker / Florian Grotz / Robert Vehrkamp / Philipp Weinmann: Reform des Bundestagswahlsystems. Bewertungskriterien und Reformoptionen
In der Diskussion über die Reform des deutschen Wahlrechts spielt die Frage nach der Anzahl der Abgeordneten infolge von Ausgleichs- und Überhangmandaten eine zentrale Rolle. So hat der 19. Deutsche Bundestag 111 Sitze mehr als regulär vorgesehen – seine Arbeitsfähigkeit ist nach Ansicht von Kritikern damit infrage gestellt. Die Autoren spiegeln die bisherige Wahlrechtsdebatte und zeigen mögliche Auswege aus dem Trade-off zwischen Proporz und Bundestagsgröße auf. Als mögliche Stellschrauben werden die Stimmverrechnung, die Stimmabgabe und die Wahlkreiseinteilung ausgemacht.