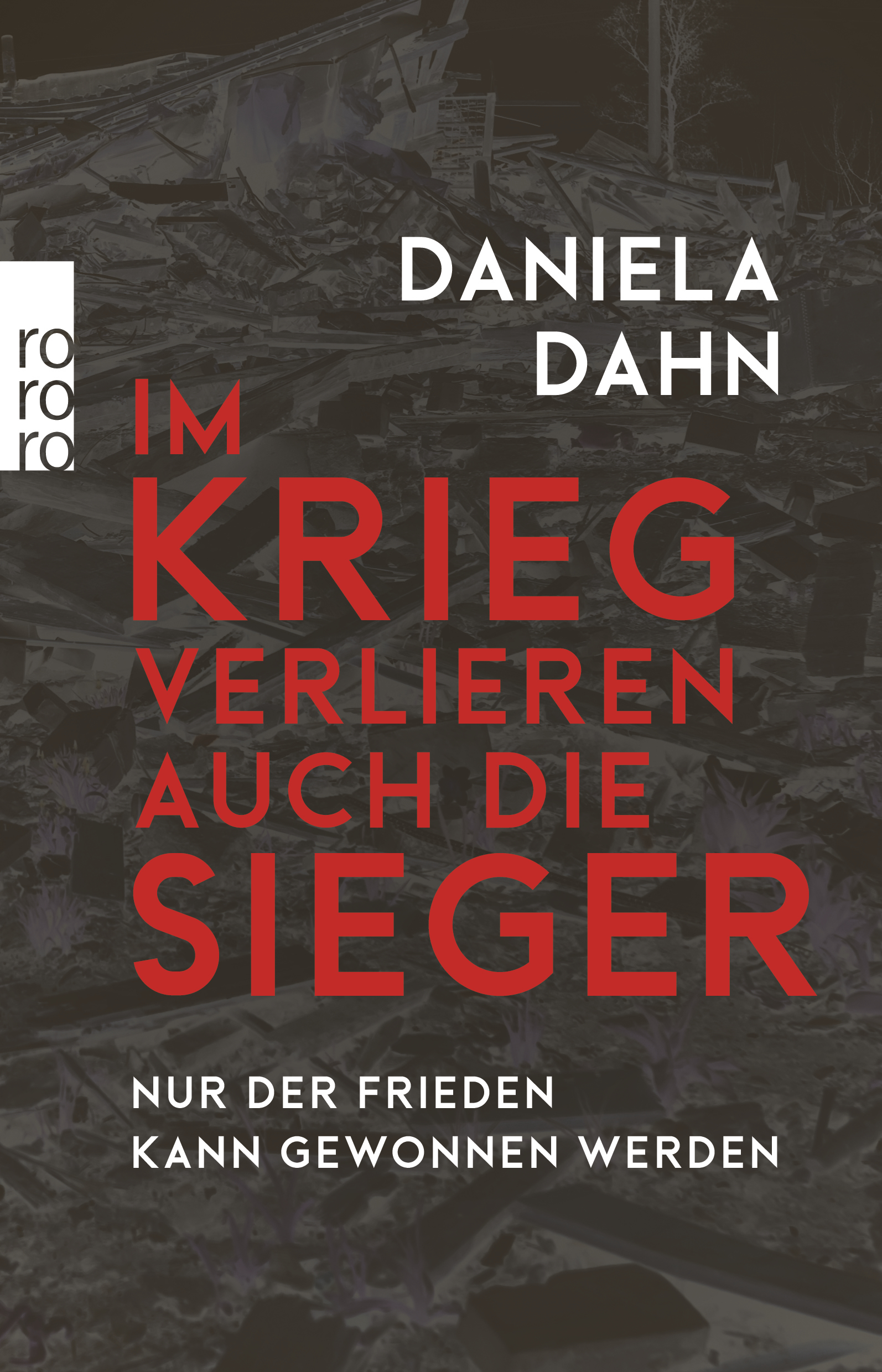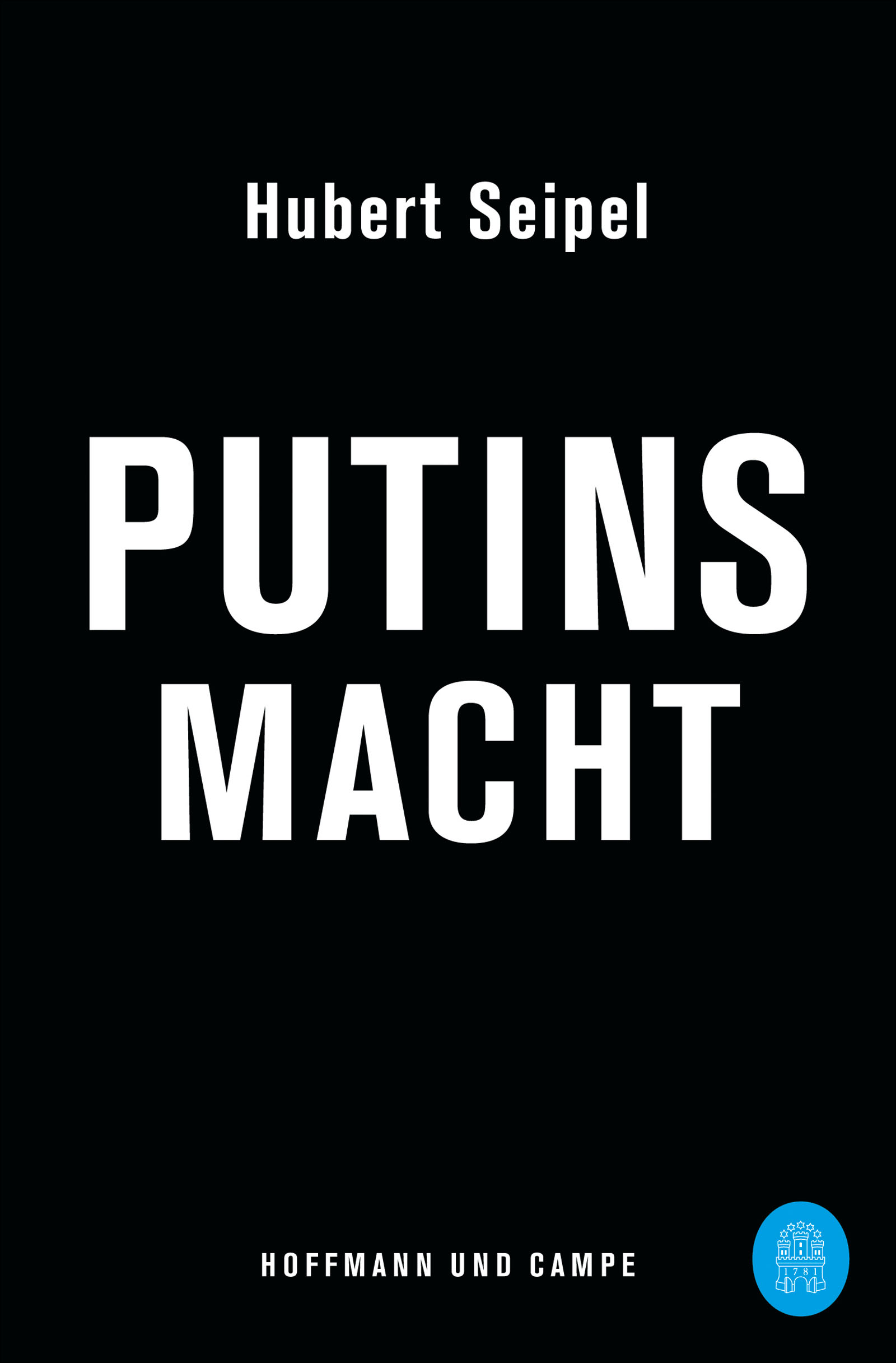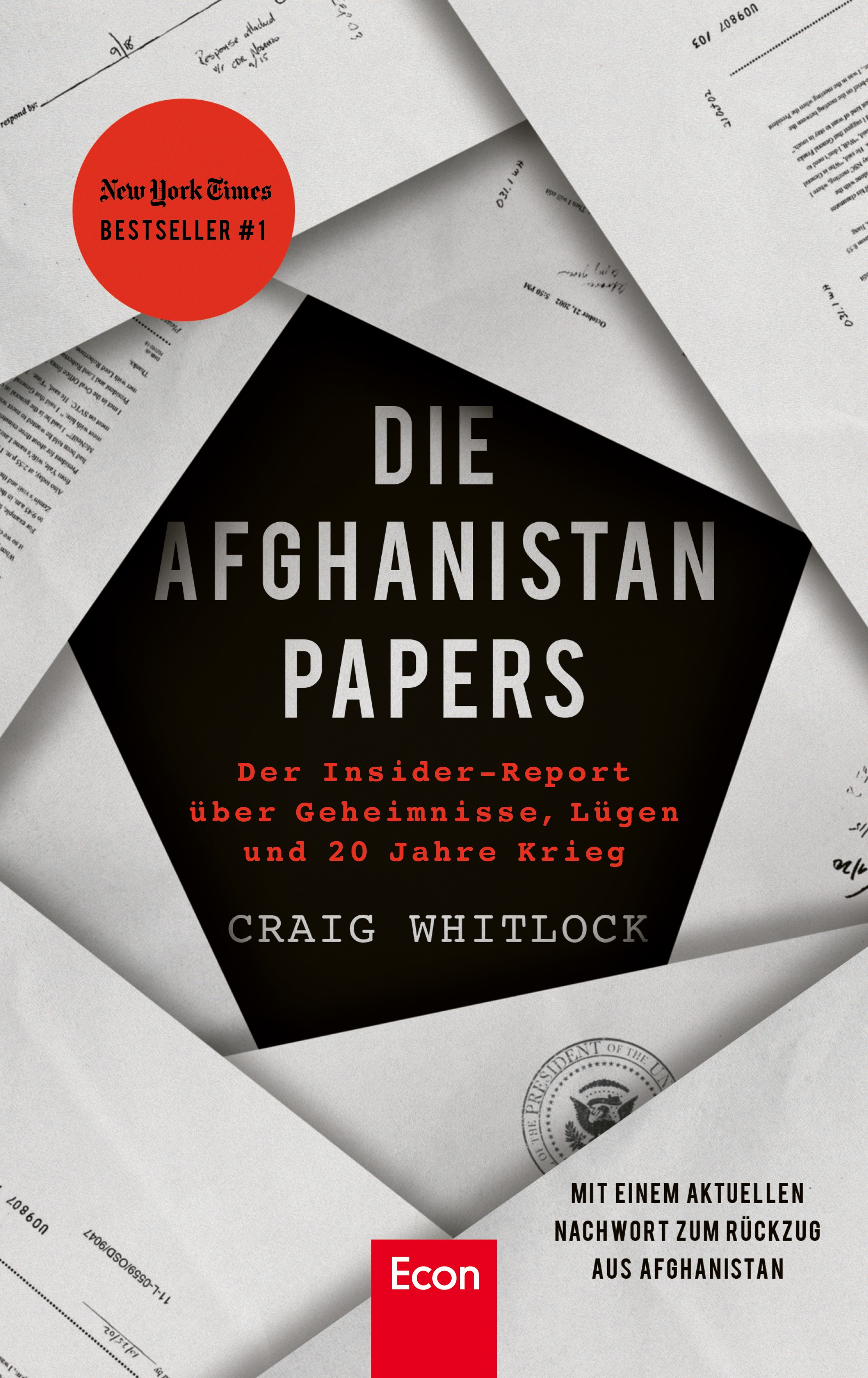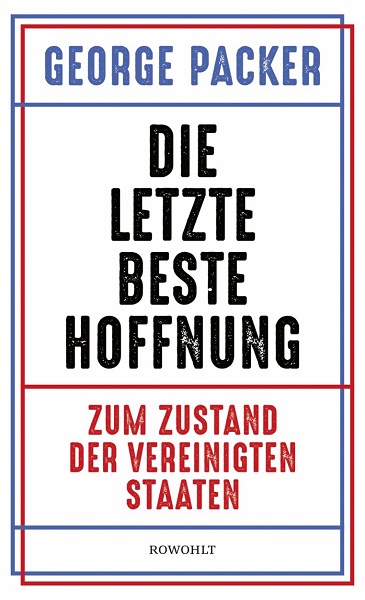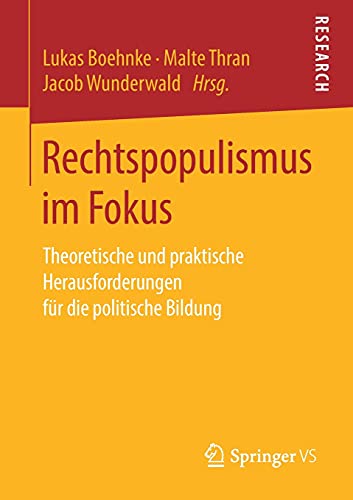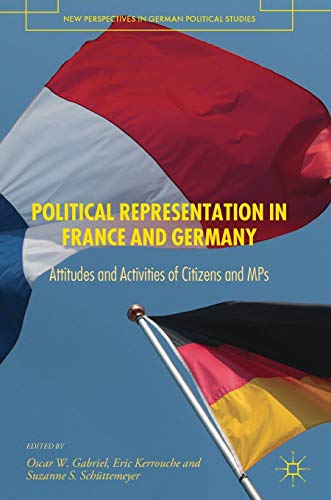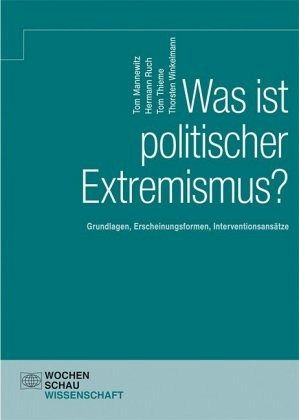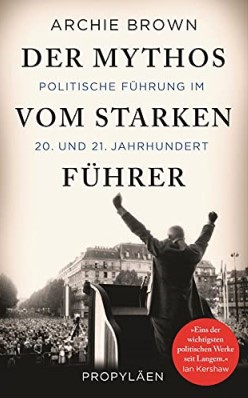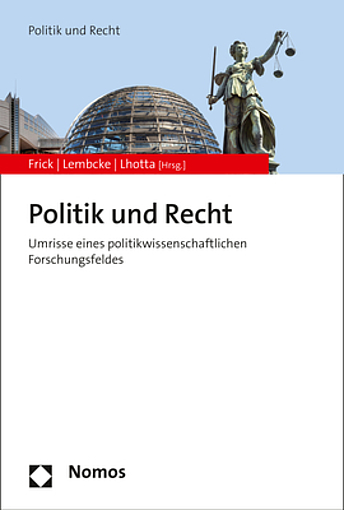Carlo Masala: Bedingt abwehrbereit. Deutschlands Schwäche in der Zeitwende
Masala befasst sich in seinem Buch mit der deutschen Sicherheits- und Militärpolitik, insbesondere im Kontext des Ukraine-Russland-Konflikts. Dabei prangert er den Zustand der Bundeswehr an, zeigt Missmanagement und bürokratische Hürden auf. Die Besprechung beleuchtet Masalas Sicht auf Russlands Motive, wirft einen Blick auf die Rolle der NATO und unterstreicht die strategische Naivität Deutschlands. Masala thematisiert zudem die Herausforderungen durch China und plädiert für einen realistischen außenpolitischen Ansatz. Unser Rezensent Arno Mohr betont, dass Masalas Ausführungen für jede/n deutsche/n Außenpolitiker*in Pflichtlektüre sein sollten.
Daniela Dahn: Im Krieg verlieren auch die Sieger. Nur der Friede kann gewonnen werden
Angesichts des Ukrainekriegs möchte die Journalistin Daniela Dahn Fakten und Quellen präsentieren, die noch nicht Eingang ins allgemeine Bewusstsein gefunden hätten. Das Buch enttäusche trotz des vielversprechenden Titels, so unser Rezensent Arno Mohr, da der Autorin dabei leider keine analytische Differenzierung gelungen sei. Das wichtige Anliegen der Friedensbewegung werde hier zu einseitig mit den stets gleichen Erzählungen über die politische, ökonomische, ideelle und militärische Einflussnahme des Westens und den damit verbundenen Fehlschlüssen verwoben.
Hubert Seipel: Putins Macht. Warum Europa Russland braucht
Die Ausführungen Hubert Seipels stoßen bei unserem Rezensenten Arno Mohr auf Unverständnis und Kritik. Zwar sei Seipel „ein renommierter, vielfach ausgezeichneter investigativer Fernsehjournalist“, doch habe er in „Putins Macht“ eine „‚verkehrte Welt‘“ konstruiert, in der er Russland die Rolle des „Guten“ und dem Westen die des „Bösen“ beimesse. So schreibe Seipel, dass Russland nur auf die Aktionen des Westens reagiere und sich gezwungen sehe, sich gegen „eine Bedrohungspolitik des Westens zur Wehr zu setzen“. Seipel mangele es an einem „wirklicheitsgerechte[n] Blick“, sodass eine Analyse der Macht Putins noch zu erstellen sei.
Craig Whitlock: Die Afghanistan Papers. Der Insider-Report über Geheimnisse, Lügen und 20 Jahre Krieg
Craig Whitlock begibt sich investigativ auf Fehlersuche in Bezug auf den Afghanistan-Einsatz, so Rezensent Arno Mohr. Dabei verdichte der Autor anonymisierte Interviewaussagen von Generälen, Diplomat*innen, Mitarbeiter*innen von Hilfsorganisationen oder afghanischen Regierungsvertreter*innen zu einem kritischen Bild vom strategischen Verlauf und Scheitern dieses Nation-Building-Projekts. Für den Rezensenten steht nach der Lektüre außer Frage, dass „Lessons-Learned“-Interviews für amerikanische Regierungen auch nach der Beendigung dieses Engagements zu einem Dauerzustand werden können.
George Packer: Die letzte beste Hoffnung. Zum Zustand der Vereinigten Staaten
George Packer stellt in „Die letzte beste Hoffnung. Zum Zustand der Vereinigten Staaten“ die vier unterschiedlichen Erzählungen dar, was jenes aktuell von Krisen geschüttelte Amerika aus den unterschiedlichen Perspektiven der seit der Nachkriegszeit auseinanderdriftenden Gesellschaft eigentlich ist: entweder frei, smart, wahr oder gerecht. Ebenso präsentiert der US-Autor die Einsicht: Wo die Gefahr wächst, ist auch das Rettende angelegt. So heiße es, sich nun auf den Geist des self government zu besinnen. Arno Mohr ist dem für uns in seiner Rezension nachgegangen.
Martin Jander / Anette Kahane (Hrsg.): Gesichter der Antimoderne
Der Aufsatzband "Gesichter der Antimoderne?“ blickt auf Bewegungen und Ideologien, die in Opposition zur demokratischen Kultur und ihren Werten stehen: Rechts- und Linksradikalismus, Rassismus, Terrorismus und insbesondere Antisemitismus, den die Herausgeber*innen als einendes Element der die Moderne ablehnenden Überzeugungssystemen betrachten. Die vorgelegten Beiträge zu den hiermit verbundenen Vorstellungswelten und Methoden analysieren vielfältige Beispiele wie die Zusammenarbeit der Staatssicherheit mit Alt- und Neonazis, den "Rassismus der Mitte?“ sowie den durch die sozialen Medien orchestrierten Schwarmterrorismus.
Das Streben nach Glück und die heroisierte Präsidentschaft. Das spezifisch „US-Amerikanische“ am Trumpismus

Jill Lapore und Wolfgang Fach geben Ausblick auf eine 250-jährige Geschichte ohne nennenswerte Zäsuren und damit Antworten darauf, welche Grundsätze das typisch „Amerikanische“ am Trumpismus ausmachen. Lepore sieht zudem im Anspruch der Liberalen, der Bösartigkeit Trumps und seiner Indifferenz gegenüber Regeln und Normen vor allem feste Grundsätze entgegenzusetzen, die Formatierung eines spezifischen „Neuen Amerikanismus“. Für Fach dokumentiert der Trumpismus vor allem das dekonstruierbar (Alb-)Traumhafte einer derart selbstbezogenen politischen Aufstiegs- und Regierungspraxis.
Stephan Bierling: America First. Donald Trump im Weißen Haus: Eine Bilanz
Rezensent Arno Mohr nimmt das Buch von Stephan Bierling, Professor für Internationale Beziehungen in Regensburg, zum Anlass, essayistisch auf die zurückliegende Regentschaft Donald Trumps zu blicken und sein Handeln unter den Schlagwörtern Byzantinismus und Caesarismus zu erörtern. Diese Prinzipien habe sich Trump zur Maxime seines Regierungshandelns beziehungsweise seiner -rhetorik gemacht. Bierling untermauere anhand zahlreicher Beispiele, dass sich Trumps Geltungssucht sowohl in der Innen- als auch der Außenpolitik gezeigt habe – zum Teil habe sie sich jedoch als kontraproduktiv erwiesen.
Danny Schindler: Politische Führung im Fraktionenparlament. Rolle und Steuerungsmöglichkeiten der Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag
Die Fraktionen zählen zu den wichtigsten Handlungseinheiten des Bundestages. Folglich kommt dem Amt des Fraktionsvorsitzenden im Parlamentsbetrieb große Bedeutung zu, dem sich Danny Schindler widmet. Die wesentliche Grundlage seiner Untersuchung bilden Leitfadeninterviews. Sie vermitteln konkrete „Einblicke in den Maschinenraum vom Fraktionsleben“, wie Rezensent Arno Mohr schreibt. Schindler gehe nicht nur auf die zahlreichen Steuerungsmöglichkeiten von Vorsitzenden ein, sondern mache auch Ausführungen, wie diese im Willensbildungsprozess der Fraktionen eingesetzt werden können.
Wolfgang Plasa: America First! Über die Rückständigkeit einer Politik der Rücksichtslosigkeit
Seit Bestehen der Vereinigten Staaten bilde die Maxime „America First“ die Grundlage des US-amerikanischen gesellschaftlichen und politischen Lebens. Kein Präsident, keine Regierung habe diese Praxis je infrage gestellt. Trump habe sie lediglich radikalisiert. Wolfgang Plasa demonstriert, wie dieses „America First“, wie diese „Pax Americana“ geformt wurde und wirft einen, wie Rezensent Arno Mohr hervorhebt, höchst kritischen Blick darauf, welche Strategien eingesetzt wurden und was daraus jeweils resultierte – mit welchen mehr oder weniger schwerlastenden Konsequenzen.
Volker Stanzel: Die ratlose Außenpolitik und warum sie den Rückhalt der Gesellschaft braucht
„Außenpolitik wächst aus der Innenpolitik“, so die These von Volker Stanzel, die er in einer kritischen Betrachtung der veränderten globalen Konfliktlagen seit 1989 entfaltet. Er plädiert für eine Aufwertung zivilgesellschaftlichen Handelns im Bereich der Außenpolitik. Denn eine auf Teilhabe und Mitverantwortung basierende Außenpolitik biete den Bürgern die Möglichkeit mitzubestimmen und umgekehrt müsse ihnen Außenpolitik so verständlich nahegebracht werden, dass sie in die Lage versetzt werden können, ihre Interessen wiederzufinden. Eine legitime Außenpolitik bedürfe zwingend der Legitimierung durch die eigenen Bürger. Und eine intelligente Außenpolitik benötige die Handhabe, „auf die Akteure eines Krisendramas Einfluss auszuüben.“
Lukas Boehnke / Malte Thran / Jacob Wunderwald (Hrsg.): Rechtspopulismus im Fokus. Theoretische und praktische Herausforderungen für die politische Bildung
Der Band enthält eine Fülle an Einsichten zum Rechtspopulismus, die nach Meinung von Rezensent Arno Mohr für politische Bildner hilfreich sind. So werde etwa nach den Voraussetzungen für dessen Aufkommen gefragt und vor ‚Scheinerklärungen‘ gewarnt, die dem Rechtspopulismus seinen eigentlich politischen Charakter absprechen: Es sei nicht wahr, dass allein die schlechte soziale Lage die Bürger*innen dazu bringe, rechts zu wählen oder sich für rechte Lösungen zu begeistern. Die These des Zusammenhangs zwischen Armut und Erstarken von Rechtspopulismus sei in Zweifel zu ziehen.
Moshe Zuckermann: Der allgegenwärtige Antisemit oder die Angst der Deutschen vor der Vergangenheit
Ist Antizionismus gleichzusetzen mit Antisemitismus? Ist Kritik an Israels Nahostpolitik gleichzusetzen mit Antizionismus? Oder gar mit Antisemitismus? Nein, sagt ganz entschieden der in Israel geborene Historiker Moshe Zuckermann. Er wehrt sich dagegen, Kritik an der Politik Israels mit dem Antisemitismus zu verbinden. Für ihn seien die Realitätswahrnehmungen aus dem Ruder gelaufen und mündeten schlicht in eine Realitätsverweigerung, schreibt Rezensent Arno Mohr. Hiergegen wolle Zuckermann mit seiner Streitschrift anschreiben.
Oscar W. Gabriel / Eric Kerrouche / Suzanne S. Schüttemeyer: Political Representation in France and Germany. Attitudes and Activities of Citizens and MPs
Aufgezeigt werden das Selbstverständnis der Abgeordneten in den nationalen Parlamenten und ihr Verhältnis zu ihren Wählern. Gefragt wird auch nach deren Erwartungen. Deutlich wird, dass deutsche und französische Abgeordnete in doch sehr unterschiedlichen politischen Kulturen agieren. Während sie in Frankreich stärker in lokale Netzwerke eingebunden sind, führt der Bundestag als Arbeitsparlament tendenziell zu einer Trennung vom Wähler. Direktdemokratischen Instrumenten wird in diesem Band eher eine Absage erteilt, da sie nicht dazu führten, die Bürger insgesamt besser zu repräsentieren.
Tom Mannewitz / Herrmann Ruch / Tom Thieme / Thorsten Winkelmann: Was ist politischer Extremismus? Grundlagen – Erscheinungsformen – Interventionsansätze
Die drei Erscheinungsformen des aktuellen Extremismus – links, rechts, islamistisch – werden in dieser Darstellung in ihrem Erscheinungsbild, ihren inneren Strukturen, ihren Strategien und insbesondere in ihren gewalttätigen Praktiken gleich unmittelbar zur demokratisch ausgelegten Verfassungsstaatlichkeit bestimmt. Unser Rezensent Arno Mohr hält diese Herangehensweise für nicht ausreichend, zumal im Ergebnis die AfD nur als „Flügelpartei der Rechten“ klassifiziert, DIE LINKE hingegen eindeutig als linksextrem eingestuft wird. Auch gelinge die Analyse von verschiedenen Protestformen vor dem Hintergrund dieses normativistischen Paradigmas nicht überzeugend.
Archie Brown: Der Mythos vom starken Führer. Politische Führung im 20. und 21. Jahrhundert
Archie Brown entwickelt eine umfassend angelegte Typologie von politischen Führungsstilen und informellen Verhaltensweisen und räumt dabei unter Heranziehung der jüngeren Geschichte manche populären Irrtümer, Fehlurteile und sich hartnäckig haltende Vorurteile aus. Das Negativbild eines starken Führers ist für ihn jemand, der taub für das Fachwissen anderer ist und sich auch deshalb nur auf persönliche Seilschaften statt auf eine Partei stützt. Politiker aber, die glaubten, die Entscheidungsfindung in zahlreichen Bereichen dominieren zu können, verdienten keine Gefolgschaft, sondern Kritik.
Johannes Hillje: Propaganda 4.0. Wie rechte Populisten Politik machen
Am Beispiel der Medienstrategie der AfD erklärt Johannes Hillje, wie Rechtspopulisten unter Nutzung der sozialen Medien mit der Propaganda 4.0 eine neue Form der Kommunikation etabliert haben. Mit subtilen Methoden, die erst durch das Internet möglich werden, gelinge es ihnen, geschickt „rechte Positionen als neue Normalität“ zu vermitteln und so auch Partei und Anhängerschaft zusammenzuschweißen. Hillje kritisiert aber auch die oft nur auf Personen und Skandale bezogene Berichterstattung über die AfD und zeigt Wege und Maßnahmen auf, populistischen Bestrebungen Einhalt zu gebieten.
Matthias Lemke (Hrsg.): Ausnahmezustand. Theoriegeschichte – Anwendungen – Perspektiven
Der Ausnahmezustand stellt die extremste Form der Behebung einer existenziellen Staatskrise dar, die determiniert, wer eigentlich der wahre Souverän der konkreten politischen Ordnung ist. In diesem von Matthias Lemke herausgegebenen Sammelband wird dessen Theoriegeschichte reflektiert und seiner Anwendung – oder Unterlassung – an höchst unterschiedlichen Beispielen (wie USA, Russland, Türkei, Griechenland oder Mexiko) empirisch nachgegangen. Auffällig ist dabei allerdings, dass die Analysen zumeist leitmotivisch eng den Definitionen Carl Schmitts verhaftet bleiben, wie Arno Mohr kritisch aufzeigt.
Josef Foschepoth: Verfassungswidrig! Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg
Der Historiker Josef Foschepoth arbeitet – gestützt auf bislang geheim gehaltene Unterlagen – die fast schon klandestinen Zusammenhänge heraus, die sich um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich des Verbots der KPD, das am 17. August 1956 verkündet wurde, rankten. Die Quellen offenbaren eine heute unvorstellbare Einmischung der Bundesregierung in den Prozessverlauf und sogar in die Zeugenbefragungen. Zeitgleich war der geschichtspolitische Versuch zu beobachten, die NS-Vergangenheit dem Vergessen anheim geben zu wollen. Die Analyse Foschepoths lässt nur einen Schluss zu: Das Verfahren zum KPD-Verbot lief verfassungswidrig ab.
Alexander Gallus (Hrsg.): Politikwissenschaftliche Passagen. Deutsche Streifzüge zur Erkundung eines Faches
Angesichts der fortgeschrittenen Ausdifferenzierung der Arbeitsfelder der Politikwissenschaft geht es in diesem Band um die Selbstvergewisserung des Faches. In Abgrenzung zum diagnostizierten Szientismus wird der Versuch einer Rückführung der Politikwissenschaft als Demokratiewissenschaft unternommen. In fünf Passagen, die die Themenfelder des Faches abbilden, befassen sich 14 Autorinnen und Autoren unter anderem mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis, von kleinteiliger Forschung und holistischer Deutung, von empirischer Arbeit und normativen Werturteilsfragen.
Verena Frick / Oliver W. Lembcke / Roland Lhotta: Politik und Recht. Umrisse eines politikwissenschaftlichen Forschungsfeldes
Das Recht habe nicht nur eine die Politik begrenzende Wirkung, schreiben die Herausgeber*innen, sondern sei auch deren Gestaltungsinstrument, das speziell in der Verfassungsgerichtsbarkeit als „Selbstermächtigung“ qua Verfassungsinterpretation charakterisiert werden könne und gleichzeitig kontrovers bleibe. In den Beiträgen werden daher neue und ertragreiche Ansätze der Rechtswissenschaften mit Blick auf politikwissenschaftliche Forschungsprobleme in Stellung gebracht.
Michael Wildt: Volk, Volksgemeinschaft, AfD. Über das Fortleben nationalsozialistischer Leitmotive
Es geht in dieser historisch-politischen Intervention des Zeithistorikers Michael Wildt um eine problembewusste und perspektivenreiche Präzisierung des Begriffs „Volk“ – insbesondere in Verbindung mit dem nationalsozialistisch infizierten Kampfbegriff „Volksgemeinschaft“ – und die Frage, wie beide in den programmatischen Positionen der AfD leitmotivisch zu politischer Geltung gebracht werden. Auslöser für die Analyse ist die rasante, für demokratisch gesinnte Politiker und Bürger unbehagliche und für viele andere attraktiv erscheinende Ausbreitung populistischer Parteien oder Bewegungen in Europa.